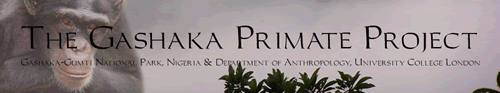Ape Tales
Bruder Affe
Affen gehören in die Familie der Menschen oder Menschen in die Familie der Affen. Was bedeutet das für uns – und was für sie?
von Volker Sommer
Wahre Goldgruben sind die Kothaufen. Und sie rennen nicht weg. Denn das tun die Produzenten der geruchsmächtigen Hinterlassenschaften leider zu oft. Obwohl wir ihnen seit vier Jahren
durchs Unterholz nachsteigen. Als Nestbeschmutzer können sie jedenfalls nicht gelten. Bei der Morgentoilette recken sie den Allerwertesten säuberlich über den Rand des Schlafnests. Bis die Mitglieder
der Gashaka-Kommunität ihre Geschäfte ungerührt vor unseren Augen verrichten werden, mag durchaus ein Jahrzehnt vergehen. So lange dauerte es andernorts in Afrika, bis wilde Schimpansen sich an
neugierige Primatologen gewöhnt hatten.
Doch selbst an dem verlassenen Schlafplatz im Gashaka-Gumti-Nationalpark in Nigeria haben wir alle Hände voll zu tun. Beispielsweise wüssten wir gerne, ob auch «unsere» Schimpansen Schlankaffen,
Schweine oder Waldantilopen jagen. Mein britischer Doktorand Andrew Fowler durchstochert die Exkremente nach Knochenresten. Wieder Fehlanzeige. Sind die nigerianischen Schimpansen zu faul zum
Beutemachen? Oder zu dumm? Gibt es genügend andere Nahrung?
Unser einheimischer Feldassistent Hammounde hält sich naserümpfend fern. Der Kot stinkt, denn Schimpansen sind wie Menschen Allesesser. Hammounde untersucht lieber die Nester. Welche Baumart wurde
gewählt? Wie wurden Äste und Blätter verwoben? Wir wollen herausfinden, ob die Schimpansen ortstypisch bauen, ob sie lokale Architekturen entwickelten. Und warum überhaupt bauen Schimpansen Nester?
Brauchen sie schlicht bequeme Nachtruhe, um ihr beträchtliches Gehirn zu regenerieren?
Andrew gibt die Fäkalien in eine Tüte, um sie im Camp in flüssigen Stickstoff einzulagern. Es grenzt an Zauberei, was Labors da an Information herausholen werden. Die DNS ausgeschiedener Darmzellen
erlaubt beispielsweise, das Geschlecht zu bestimmen und damit, ob Männchen Nester anders bauen als Weibchen. Ausserdem lässt sich der Kot als Speisezettel lesen, weil jede verzehrte Pflanzenart ein
unverwechselbares Profil ungesättigter Fettsäuren hinterlässt. Durch unsere Detektivarbeit wollen wir aber nicht nur mehr über Schimpansen lernen, sondern auch mehr über unsere eigene Herkunft. Denn
wie wir wurden, was wir sind: In der Hinsicht halten uns Affen den Spiegel vor. Es diente unserer Selbsterkenntnis ungemein, dass Charles Darwin 1871 behauptete, der Mensch stamme vom Affen ab. Damit
stellte er jenes Schema auf den Kopf, wonach der von Gott engelgleich erschaffene Mensch durch die Sünde zu Fall kam. Darwin kehrte den «Abstieg von den Engeln» um in einen «Aufstieg von den Affen»,
machte aus einer eher schmeichelhaften «Devolution» eine ernüchternde «Evolution».
Noch immer fühlen sich Menschen hierdurch in ihrer Würde verletzt, sehen sie Affen doch als Karikaturen, als unvollkommene Entwürfe für die Krone der Schöpfung. Und Geisteswissenschafter postulieren
noch immer dogmatisch einen unüberbrückbaren Graben zwischen «dem Tier» und «dem Menschen». Dabei kann es so faszinierend sein, sich dem Evolutionsgedanken radikal zu öffnen, sich als lediglich eine
besondere Art von Tier zu begreifen. Für mich ist es nicht erniedrigend, sondern erhebend, mit allen anderen Lebensformen verbunden zu sein durch einen äonenalten Strom von Generationen. Ich gehöre
zu jenen Anthropologen, die den Menschen im Tier ebenso eifrig suchen – also anthropomorphisieren – wie das Tier im Menschen – also zoomorphisieren.
Als Jane Goodall vor mehr als vierzig Jahren ihre bahnbrechenden Beobachtungen an wilden Schimpansen in Tansania begann, wurde ihr vorgeworfen, nicht objektiv zu sein. Denn statt Nummern gab sie
ihnen Namen, David Greybeard etwa oder Hugo. Durchaus nicht unangemessen für Wesen, die Werkzeuge herstellen, Kriege mit Nachbarn führen, sich in Menschenobhut verständigen mit Hunderten von
Handzeichen oder einer Computertastatur. Weil wir inzwischen so viel gelernt haben über das, was Menschenaffen können, hielt ich es für angemessen, die Goodall-Tradition umzudrehen: Mein Sohn Kalind
ist nach einem Menschenaffen benannt.
Affen sind den Menschen nahe, aber die Nähe ist nur ein Beinahe. Das führt zu einem Dilemma: Weil uns hinreichend ähnlich, werden unsere Verwandten als abgerichtete Witzfiguren in Fernsehen und
Zirkus missbraucht, zum Anstarren in Zoos eingesperrt oder als Lieferanten von Blut und Organen ausgeschlachtet. Sie gelten jedoch zugleich als hinreichend verschieden von uns, so dass ihnen keine
Rechte zustehen. Den Graben zwischen uns und ihnen schüttet aber nicht nur die Verhaltensforschung rasant zu, sondern auch die moderne Genetik. Wie wir in Nigeria sammeln Primatologen vielerorts
Haare oder Darmzellen, aus denen sich molekularbiologische Marker extrahieren lassen. Und was sich da an Einsicht zusammenbraut, revolutioniert unser Weltbild.
Demnach ist es wissenschaftlich unhaltbar, überhaupt zwischen Menschen und Menschenaffen zu unterscheiden. Vielmehr belegen Vergleiche von Proteinen, Chromosomen und Genen, dass sich von der
gemeinsamen Urform zunächst die Orang-Utans abspalteten, vor 12 bis 13 Millionen Jahren, bevor die Gorillas, vor 7 bis 8 Millionen Jahren, einen eigenen Weg einschlugen. Die Stammform von Menschen
und Schimpansen spaltete sich hingegen erst vor 5 bis 6 Millionen Jahren auf. Die Schimpansen teilten sich vor 2 Millionen Jahren nochmals in die Formenkreise Schimpanse (Pan troglodytes) und Bonobo
(Pan paniscus) .
Somit stehen Schimpansen den Menschen näher als den Gorillas! Durchaus angebracht also wäre es, Menschen als «dritte Schimpansen» zu begreifen. Manche Molekularbiologen fordern sogar radikalere
Umbenennungen. Schon seit gut zwei Jahrzehnten gilt das Erbgut von Schimpanse und Mensch als zu 98 bis 99 Prozent identisch. Laut einer Arbeit, die in diesem Juni von einem Forschungsteam um Morris
Goodman publiziert wurde, stimmen bestimmte Gensequenzen zu 99,4 Prozent überein. Goodman plädiert deshalb dafür, Schimpansen und Bonobos endlich in die ausschliesslich für Menschen reservierte
Gattung Homo aufzunehmen. In der Tat: Selbst der begnadetste Haarspalter muss bei 0,6 Prozent Unterschied einfach aufgeben, soll das System zoologischer Klassifikationen nicht ad absurdum geführt
werden.
Zooschilder auf «Homo troglodytes» und «Homo paniscus» ändern zu müssen, würde bloss unseren Stolz verletzen. Wenn Schimpansen und Bonobos jedoch zur Gattung Mensch zählen – macht sich Homo sapiens
dann nicht des Genozids schuldig? Und müssten wir unseren Mit-Menschen nicht Menschenrechte zugestehen? Genau das fordert der australische Philosoph Peter Singer seit 1993 für die grossen
Menschenaffen, unterstützt von namhaften Primatologen wie Jane Goodall, Biruté Galdikas, Roger Fouts, Toshisada Nishida und Takayoshi Kano. Sie alle halten Menschenaffen für Personen und wenden sich
gegen die Zerstörung ihrer natürlichen Heimaten, ihre Tötung bei der Jagd und ihre Verwendung in biomedizinischen Labors.
Extrembeispiele: In den USA werden Schimpansen mit Hepatitis oder Aids infiziert; sie sterben qualvoll oder siechen über Jahrzehnte in Einzelhaft dahin. Andere Eingriffe sehen vor, ihnen die
Bandscheiben zu entfernen, worauf die Wirbel zusammenwachsen und sie zu Krüppeln werden. Wer kann solche Grausamkeit rechtfertigen, wenn handfeste Forschung nahelegt, was dem Gemeinsinn ohnehin klar
ist: dass Affen ähnlich wie wir denken und fühlen und somit leiden können? Menschen derart zu missbrauchen, verbietet sich von selbst. Und genau dieses Selbstverständnis sollte auch auf unsere
Mitprimaten zutreffen.
Viele Affenforscher sehen das anders. Man könne Menschenaffen keine Rechte zubilligen, da sie keine Pflichten übernähmen und wir sie nicht fragen könnten, ob sie überhaupt zur Gemeinschaft der
Gleichen zählen wollten. Dies sind jedoch schwache Argumente; folgt man ihnen, müssten pflicht- und sprachlose Menschen ebenfalls von Grundrechten ausgeschlossen werden – Säuglinge etwa, geistig
Behinderte oder Kranke im Koma. Deren Interessen aber werden vertreten von Verwandten oder Richtern; eine ähnliche Vormundsrolle käme Fürsprechern für Orang-Utans, Gorillas, Schimpansen und Bonobos
zu. Anderen gehen die Forderungen nicht weit genug: Warum sollen Paviane oder Rhesusaffen ausgeschlossen werden? Und was ist mit hochintelligenten Walen, Elefanten oder Papageien?
Zudem: Müssen Menschenaffen bestraft werden, wenn sie Konkurrenten oder Babies umbringen? Was etwa soll mit jenem Schimpansen geschehen, der letztes Jahr der Frau eines tansanischen Wildhüters das
Kind aus dem Wickeltuch raubte und teilweise aufass?
Derlei Fragen lassen sich in Ruhe gar nicht mehr überlegen – bald wird es kaum noch wilde Menschenaffen geben. In nur 23 Ländern und zunehmend aufgesplitterten Populationen überleben vielleicht noch
250 000, gerade zwei Drittel der Einwohnerzahl von Zürich. Ihr Lebensraum wird flächendeckend zerstört, nicht zuletzt wegen unserer Konsumbedürfnisse. Im Kongobecken sägt die Firma Danzer aus
Pforzheim Edelhölzer um; die deutsche Gesellschaft für technische Zusammenarbeit öffnete im Osten des Kongo durch Strassenbau einen Nationalpark für illegale Siedler; um das Entlausungsmittel
«Goldgeist» aus der Pyrethrum-Blume zu gewinnen, wurde der Virunga-Park in Rwanda dezimiert; Bürgerkriege und Flüchtlingsströme berauben die Affen ihrer Existenzgrundlage.
Selbst wir, die wir mit unserer Forschung im afrikanischen Busch praktischen Naturschutz betreiben, indem wir Wilderer abschrecken, Einheimischen Arbeit verschaffen, den Tourismus ankurbeln – selbst
wir entgehen schuldhafter Verstrickung nicht. So lebten im kongolesischen Kahuzi-Biega-Park noch vor vier Jahren Tausende von Gorillas; praktisch alle wurden massakriert und aufgefressen von jenen,
die dort illegal nach Coltran graben. Dieses Erz wird in Mobiltelefonen verwendet – auch in der Satellitenanlage, die unsere Feldstation mit der Aussenwelt verbindet. Ölmultis rotteten Schimpansen im
weiten Nigerdelta aus – was uns Treibstoff für Geländefahrzeuge beschert. Und das Palmöl, mit dem wir im Camp Zwiebeln schmoren, stammt aus Plantagen, für die Urwälder gerodet wurden.
Es ist wahrlich eine Affenschande, dass Milliarden von Dollars ausgegeben werden, um auf dem Mars nach einem Fünkchen Leben zu suchen, während wir praktisch tatenlos zusehen, wie unsere
Blutsverwandten vom Antlitz der Erde getilgt werden. Und das gerade jetzt, wo Forschungen in Labor und Wildnis gleichermassen suggerieren, dass unsere haarigen Cousins eigentlich unsere haarigen
Geschwister sind.
Den Mythos vom Menschen als einzigem Kulturwesen haben Schimpansen jedenfalls entzaubert. Wie Kollegen andernorts fertigen auch unsere nigerianischen Menschenaffen ein Arsenal an Werkzeugen. Sie
schälen die elastischen Mittelrippen aus grossen Blättern, um Ameisen oder Termiten aus ihren Bauten zu angeln. Die Enden kurzer Stöckchen zerkauen sie zu Bürsten, was die Oberfläche vergrössert und
mehr Insekten zum Anbeissen veranlasst. Mit langen Ästen fangen sie wild beissende Treiberameisen aus sicherer Distanz. Im Kot finden wir zuweilen unverdaute Blätter, an denen Würmer hängen. Die
rauhen Spreiten wurden sorgsam gefaltet und unzerkaut geschluckt – ein starker Beleg für die erst kürzlich entdeckte Fähigkeit der Menschenaffen zur Selbstmedikation. Der Disziplin der Ethnobotanik
tritt jene der Zoopharmakologie zur Seite.
Unser Projekt widmet sich den erst kürzlich als Unterart anerkannten nigerianischen Schimpansen, was wertvolle Vergleiche mit anderen Bevölkerungen ermöglicht. Denn es scheint, dass jede
Schimpansen-gemeinschaft über ein unverwechselbares Repertoire an Gewohnheiten verfügt. Interessant sind vor allem jene, die nicht auf Umwelteinflüsse zurückgehen. In manchen Gegenden, aber eben
nicht allerorten, fassen sich Schimpansen bei der gegenseitigen Fellpflege an den hochgereckten Händen, oder sie betupfen Wunden mit Blättern, kratzen sich mit Steinen oder Ästen und springen bei
beginnendem Regen erregt herum. Über Arme, Blätter, Steinchen oder Beine zum «Regentanz» verfügen Schimpansen aber überall. Mithin wurden diese Traditionen örtlich entwickelt und sozial
weitergegeben: ein kultureller Transfer.
Ein anderes Beispiel: In Westafrika werden hartschalige Nüsse unter Einsatz von Hämmern und Ambossen aus Stein oder Holz geknackt. Das Schweizer Forscherpaar Christophe und Hedwig Boesch
dokumentierte, dass die nur spärlich vorkommenden Hämmer manchmal über einen halben Kilometer zu den Bäumen geschleppt werden, unter denen dann regelrechte Nussschmieden entstehen. Ostafrikanische
Schimpansen hingegen zerschlagen keine Nüsse; ihre Populationen brachten offenbar keine genialen «Knacker» hervor.
Wie wir bei Menschen von einem japanischen oder französischen Kulturkreis sprechen, erlauben die äffischen Brauchtumsprofile den Primatologen, Schimpansen etwa der ostafrikanischen Gombe-Kultur oder
der westafrikanischen Taï-Kultur zuzuordnen. Dies bedeutet übrigens, dass der gegenwärtige Holocaust an Menschenaffen nicht nur die Biodiversität des Planeten verarmen lässt, sondern auch seine
kulturelle Vielfalt.
Mit jedem weiteren Forschungstag mausert sich die Schimpansenforschung mehr zur Völkerkunde, ergänzt sich die Anthropologie durch Panthropologie. Damit ist eine paradoxe Situation enstanden. Während
die Liste von Gemeinsamkeiten wächst, verkürzt sich die der Verschiedenheiten. Und dennoch: Obwohl ich das Etikett Affenmensch durchaus nicht als ehrenrührig empfinde, wird mich kaum jemand mit einem
Schimpansen verwechseln. Zumal mir die Zunge aus dem Hals hängt beim Versuch, ein Kliff zu bezwingen, das die Schimpansen soeben spielerisch erklettert haben. Der ach so kleine Unterschied von 0,6
Prozent muss es in sich haben. Einerseits könnte es sein, dass selbst identische Gensequenzen ganz verschiedene Regulationen auslösen. Andererseits wurden bisher nur Gene untersucht, deren Funktion
bekannt ist. Doch die Bauanleitung dafür, dass Schimpansen sechsmal stärker sind als ich, steckt vielleicht in der beträchtlichen «Müll-DNS», die noch kaum erforscht ist. Auf jeden Fall verlangen
Molekularbiologen wie der Schweizer Pascal Gagneux in Verlängerung des Human Genome Project ein Great Ape Genome Project, das die Erbanlagen von Menschenaffen komplett entschlüsseln soll.
Dafür brauchten wir Körbe voll Kot aus aller Herrentiere Ländern. In der breitgefächerten Artenvielfalt, die wir benötigten, um ihre polygenetischen und multikulturellen Dimensionen wirklich zu
verstehen, werden unsere nächsten Verwandten allerdings kaum überleben. Deshalb flüchte ich gern in evolutionsbiologischen Fatalismus. Demnach gibt es kaum einen rationalen Grund, das Artensterben zu
bedauern. Ich kann mich auf keine gottgegebene Ordnung berufen, nach der es auf Erden maximal sechs Milliarden Menschen geben soll und dafür mehr Menschenaffen. Und wieso sollten Schimpansen ein
höheres Existenzrecht haben als Kühe? Wieso sollen Menschen nicht den ganzen Planeten ummodeln? Schliesslich ist unsere Konkurrenzstärke ebenfalls ein Produkt der Evolution.
Sosehr mich dies intellektuell überzeugt, mein ästhetisches Lebensgefühl rebelliert dagegen. Weil ich mehr möchte als nur Menschen und Maiskolben. Ich will Vielfalt, wie ich sie in den Wäldern
Gashakas finde. Da die einheimischen Muslime kein Affenfleisch essen und der Nationalpark so abgelegen ist, tummeln sich hier noch Tausende von Primaten. Allerorten bellt Gogo, wie der Grüne Pavian
auf Hausa heisst, lugt Bakinbiri aus dem Laub, die Weissnasenmeerkatze, tönt der Gonglaut von Gimchiki, der seltenen Mona-Meerkatze, wuselt Kirikaa, die Grüne Meerkatze, und singt Biri mai roro –
«der Affe, der ruft», wie der schwarzweisse Guereza wegen seiner Morgenchöre genannt wird.
Ganz ungeniert anthropozentrisch schlägt mein Herz allerdings besonders für Biri mai ganga, die Affen mit der Trommel. Mit Händen und Füssen hämmern sie Staccatos auf die Flügelwurzeln mächtiger
Urwaldbäume – um ihren Status anzuzeigen und mit anderen Grüppchen zu kommunizieren. Welche Geheimnisse mögen die Schimpansen sich wohl per Buschtrommel mitteilen?
Ich bin dankbar für das Privileg, einem solch paradiesischen Pandämonium beizuwohnen. Ach ja, beinahe hätte ich vergessen: Ab jetzt heisst es natürlich Homodämonium.
Volker Sommer hat an der Universität London den Lehrstuhl für Evolutionäre Anthropologie inne. Seit Jahrzehnten erforscht er wilde Primaten, vor allem indische Tempelaffen, Gibbons im Regenwald Thailands und die Schimpansen Nigerias. Er ist Autor mehrerer Sachbücher, unter anderen «Von Menschen und anderen Tieren» (Hirzel, 2000).