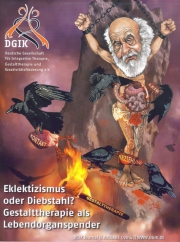DGIK-Interview
Auszug aus einem Interview für das DGIK-Journal 1/2014
Herr Dr.Goldner, seit einigen Jahren widmen Sie sich verstärkt den Tierrechten. Ich würde gerne von Ihnen mehr über diesen Schritt von der Arbeit mit Menschen zu der Arbeit mit Tieren verstehen.
Der Einsatz für notleidende Tiere war mir schon immer ein Herzensanliegen. Nach Mitgliedschaft in verschiedenen Tierschutzvereinen seit Jugendtagen habe ich, zusammen mit einigen BerufskollegInnen, vor zehn Jahren eine eigene Tierrechtsorganisation begründet, „rage&reason“, die sich bewusst abheben will von den zahllosen Gruppierungen und Vereinen der Szene, die ganz offenkundig nur oder in erster Linie existieren, um Spenden zu sammeln, deren Verwendung in der Regel auch noch unzureichend dokumentiert oder ausgewiesen wird. Die Spendenskandale um das „Deutsche Tierhilfswerk“ oder „Arche 2000“ dürften vielen noch in Erinnerung sein. Auch das zwischen den einzelnen Vereinen und Verbänden vorherrschende Konkurrenz- und Hegemonialgebaren war mir ungeheuer auf den Senkel gegangen, desgleichen die Postenschiebereien, das Kompetenzgerangele, die Profilierungssucht vieler Aktiver, von den undemokratischen Strukturen, der Mittelunterschlagung und dem Mobbing unliebsamer Mitglieder in vielen Vereinen ganz zu schweigen. Auch die bedenkliche Nähe der Szene zu rechtslastiger Esoterik – Stichwort „Universelles Leben“ – bewog mich, eine eigene Organisation ins Leben zu rufen, ganz abgesehen von der oftmals eklatanten Theorie- und damit Ahnungslosigkeit, von der sie durchzogen ist. Vielfach ist das „Tiereschützen“ von romantisch angehauchten Idealen motiviert - sofern es nicht um pure Wichtigtuerei geht, um Spendenabzocke oder besonders häufig: um Gutmenschengehabe in Kompensation der Ausbeutung anderer als eben der paar beschützten Tiere -, eine politisch-diskursive Streitkultur gibt es ebensowenig wie ein Handeln nach politischen Überlegungen. Antispeziesismus kommt in der Regel noch nicht einmal als Begriff vor. Auch von Veganismus sind viele der traditionellen Tierschützer Lichtjahre entfernt: man tätschelt Hunde und Katzen, verzehrt aber bedenkenlos Hühner, Schweine und Rinder, deren Qualhaltung und Tötung man damit stillschweigend in Kauf nimmt.
Über tierrechtstheoretische und insofern auch publizistische Arbeit hinaus engagiere ich mich sehr praktisch in einem Asyl für ausgesetzte oder beschlagnahmte große Hunde. Eines meiner Langzeitprojekte ist das gesetzliche Verbot der Ausübung von Veterinärheilkunde ohne Approbation, sprich: die Abschaffung sogenannter Tierheilpraktiker, die, ähnlich wie Humanheilpraktiker bei menschlichen Patienten, ohne ernstzunehmende Ausbildung oder Qualifikation an kranken Tieren herumdilettieren. Ein anderes Projekt ist die kritische Untersuchung und Bewertung „tiergestützter“ Therapieverfahren, insbesondere der sogenannten „Delphintherapie“, die, angeboten mithin im Tiergarten von Nürnberg, den Eltern behinderter Kinder für viel Geld nichts als unbegründete Hoffnungen verkauft und dazu beiträgt, dass Delphine weiterhin in absurd winzigen Betonbecken gehalten werden dürfen.
Momentan arbeiten Sie u. a. an einem Buch innerhalb des Great Ape Project, in dem es um Grundrechte für Menschenaffen geht. Können Sie uns darüber berichten?
Das stimmt, seit 2011 arbeite ich gewissermaßen hauptberuflich für das Great Ape Project. Es handelt sich dabei um eine vor zwanzig Jahren bereits lancierte Initiative der italienischen Philosophin Paola Cavalieri und des australischen Bioethikers Peter Singer, die darauf abzielt, den Großen Menschenaffen - Orang Utans, Gorillas, Schimpansen und Bonobos - bestimmte Grundrechte zu verschaffen, die bisher nur für Menschen gelten: das Recht auf Leben, auf Freiheit und auf körperliche wie psychische Unversehrtheit. Cavalieri und Singer wiesen überzeugend nach, dass die tradierte Ungleichbehandlung von Menschen und Großen Menschenaffen im Lichte wissenschaftlicher Erkenntnis nicht länger haltbar und damit moralisch zu verwerfen ist. Letztlich gibt es kein vernünftiges Argument, den Menschenaffen solche Grundrechte zu verweigern. Wir wissen heute, nicht zuletzt durch die Freilandforschungen von Jane Goodalls oder Biruté Galdikas, dass sie tradierte Formen von Kultur haben, einschließlich der Fähigkeit, Werkzeuge herzustellen oder bei Krankheiten bestimmte Heilkräuter einzusetzen; dass sie Ich-Bewußtsein haben samt einer Vorstellung von Vergangenheit und Zukunft; dass sie über kognitive, soziale und kommunikative Fähigkeiten verfügen, die sich von denen des Menschen allenfalls graduell unterscheiden und dass sie emotional genau so empfinden wie dieser. Die Befunde der modernen Genetik machen es naturwissenschaftlich unhaltbar, überhaupt noch zwischen Menschen und Menschenaffen zu unterscheiden: die Erbgutunterschiede etwa zwischen Mensch und Schimpanse bewegen sich im Promillebereich. Wir geben zwar zu, um mit Richard Dawkins zu sprechen, dass wir den Menschenaffen ähnlich sind, wollen aber nur selten erkennen, dass wir Menschenaffen sind.
Die Forderung nach elementarer Gleichstellung der Großen Menschenaffen, so der Grundgedanke des Great Ape Project, setzt einen Entwicklungsverlauf fort, der allgemein in der Menschheitsgeschichte erkennbar ist: Anfangs bezogen sich ethische Empfindungen fast ausschließlich auf die eigene Sippe, danach auf gesellschaftliche Teilgruppen, später auf die Mitglieder einer Gesellschaft, schließlich, mit der UN-Menschenrechtserklärung, auf alle Menschen. Warum sollten wir hier haltmachen und die Interessen leidens- und freudefähiger Primaten ignorieren, bloß weil sie keine Menschen sind? Der historische Moment ist gekommen, um nach Nationalismus, Rassismus, Ethnozentrismus und Sexismus auch die Schranke des Speziesismus zu überwinden, der die Diskriminierung von Lebewesen aufgrund ihrer Artzugehörigkeit rechtfertigt. Wie im Falle „unmündiger“ Menschen - Kleinkinder, Behinderte, demenzkranke alte Menschen usw. -, die nicht für sich selbst sprechen und ihre Rechte nicht selbst formulieren können, sollten Rechtsansprüche von Menschenaffen durch Sachwalter vertreten und gegebenenfalls auch eingeklagt werden können. Eine entsprechende Initiative zur Erweiterung des Grundgesetzes in Artikel 20a wurde bereits auf den Weg gebracht.
De Frage, wie gerechtfertigt die anthropozentrische Jurisdiktion heute noch ist, verbinde ich mit der Frage, ob Sie diesen möglichen Paradigmenwechsel mit der so genannten Kopernikanischen Wende – vom geozentrischen zum heliozentrischen Weltbild – vergleichen würden.
Bezugnehmend auf die Forderungen des Great Ape Project stellte Neuseeland 1999 per Gesetz die Großen Menschenaffen unter besonderen Rechtsschutz, gefolgt wenig später von der Inselgruppe der Balearen, die als autonome Gebietskörperschaft Spaniens einen noch weiter gefassten Rechtsschutz verfügten. Nach diesen ersten Erfolgen aber verlor das Great Ape Project im Jahre 2008 fast schlagartig sein bis dahin aufgebautes Momentum. Der Grund dafür lag in der frustrierenden Entwicklung, die das Projekt in Spanien genommen hatte: eine parlamentarische Initiative mit dem Ziel, den besonderen Status der Großen Menschenaffen für das ganze Land legislativ anzuerkennen, war unmittelbar vor ihrem Durchbruch noch auf ganzer Linie gescheitert. Die spanische Regierung unter dem seinerzeitigen Ministerpräsidenten José Luis Zapatero, die vom Umweltausschuß des Parlaments aufgefordert worden war, ein entsprechendes Gesetz auf den Weg zu bringen und sich auf EU-Ebene für das Anliegen des Great Ape Project einzusetzen, war letztlich vor der katholischen Kirche des Landes eingeknickt, die in einer beispiellosen Hetzkampagne von sämtlichen Kanzeln herunter dagegen zu Felde gezogen war. Die spanischen Medien übernahmen flächendeckend die Position des Klerus: die mit so großen Hoffnungen für die Affen verbundene Sache war vom Tisch. Auch hierzulande zählt die katholische Kirche seit je zu den erbittertsten Gegnern des Great Ape Project. Im Jahre 2011 hat die Giordano Bruno-Stiftung das Project auf ihre Agenda gehoben, ich arbeite im Auftrage der Stiftung an der Neubelebung.
Wenn Sie in die Zukunft blicken, wird es aus Ihrer Sicht eines Tages eine Höherberechtigung oder gar Gleichstellung von Menschenaffen gegenüber den Menschen geben, und welche Konsequenzen wären damit aus Ihrer Sicht verbunden?
Das Grundrecht auf Leben, auf individuelle Freiheit und auf körperliche wie psychische Unversehrtheit würde praktisch alle Fälle erfassen, die Menschenaffen in Bezug auf Menschen betreffen können: Jagd, Wildfang, Zirkus, Zoo, Tierversuche und Zerstörung ihres Lebensraumes. Für hierzulande in Zoos oder in Privathand gehaltene. Menschenaffen würde es bedeuten, dass sie ihren Interessen und Bedürfnissen entsprechend untergebracht werden müssten. Immer unter dem Blickwinkel, dass die heute in Zoos oder sonstiger Gefangenschaft lebenden Tiere realistischerweise nie mehr in ihre natürlichen Lebensräume werden zurückkehren können - sie hätten größtenteils keine Überlebenschance, ganz abgesehen davon, dass es diese Lebensräume vielleicht gar nicht mehr gibt -, bedarf es der Schaffung geschützter Refugien in klimatisch dafür geeigneten Regionen. In den USA gibt es bereits eine Reihe derartiger Sanctuaries für Menschenaffen aus der Unterhaltungsindustrie, der Pharmaforschung oder aus dem Weltraumprogramm der NASA. Bis zur Schaffung solcher Refugien hierzulande müssen die 38 Zoos, die Große Menschenaffen vorhalten, verpflichtet werden, die Unterbringung der Tiere entsprechend zu verbessern.
Zur viel und kontrovers diskutierten Frage, was den Einsatz gerade für Menschenaffen rechtfertigt, durch deren allfälligen Einbezug in die Rechtsgemeinschaft der Menschen sich nur die Grenzlinie verschöbe und nun Menschen und Menschenaffen auf der einen von allen anderen Tieren auf der anderen Seite trennte, woraus letztere - Elefanten, Delphine, Kühe, Schweine, Hühner bis hin zu den Wirbellosen - keinerlei Nutzen bezögen, ist in aller Pragmatik zu sagen: irgendwo muß man anfangen. Zudem - und das ist das Entscheidende - stellen Menschenaffen den Dreh- und Angelpunkt des Verhältnisses Mensch-Natur dar, sie definieren wie nichts und niemand sonst die sakrosankte Grenzlinie zwischen Mensch und Tier: sind sie festgeschrieben „auf der anderen Seite“, sind das alle anderen Tiere mit ihnen. Würde die Grenze durchlässig, könnte das in der Tat jener „Türöffner“ sein, als den auch Singer und Cavalieri das Great Ape Project verstehen, der letztlich allen Tieren – den menschlichen wie den nicht-menschlichen - zugute käme. Im besten Fall könnte das Öffnen eines ersten kleinen Spaltes zu eben jenem Dammbruch führen, den die Vertreter der „alten Ordnung“ so sehr befürchten: zu einem radikalen Wandel des gesellschaftlichen Konsenses über das bisherige Verhältnis Mensch-Tier.
Gesprächspartner: Dr. Mathias Probandt