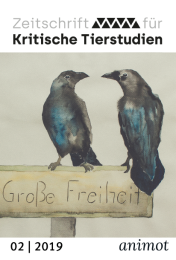Kritische Tierstudien
Der folgende Text stellt die überarbeitete Version eines Vortrages dar, den der Autor auf dem 5. Tierschutzseminar des Bundesverbandes der Veterinärmedizinstudierenden in Deutschland (bvvd e.v.) an der Universität Leipzig gehalten hat (21.–23.6.2019). Er erschien in Band 2 der Zeitschrift für Kritische Tierstudien (Animot-Verlag, Lengerich, ISBN 978-3-948157-02-9 ISSN 2627-4965, November 2019).
Mangelhaft bis Ungenügend
Zur pflegerischen und veterinärmedizinischen Unter-versorgung von Zootieren
von Colin Goldner
Zoos und zooähnliche Einrichtungen suchen gezielt den Eindruck zu erwecken, den zur Schau gestellten Tieren mangele es an nichts, würden sie doch von fachlich hochqualifiziertem Pflege- und Veterinärpersonal betreut und versorgt. Bei Lichte besehen stellt sich indes ein ganz anderes Bild dar.1
Tatsächlich gibt es erst seit 2003 eine bundesweit geregelte und staatlich anerkannte Ausbildung zum/zur „Tierpfleger/ Tierpflegerin – Fachrichtung Zoo“, die in einer dreijährigen dualen Lehre – in einem Ausbildungsbetrieb (Zoo) und begleitender Berufsschule – absolviert wird.2 Bis dahin war die Tätigkeit des „Zootierwärters“, wie man früher dazu sagte, an keinerlei formale Qualifikation gebunden gewesen.
Allerdings kann auch eine geregelte dreijährige Ausbildung keine ausreichenden Kenntnisse über einen fachgerechten Umgang mit Tieren hunderter verschiedener Arten vermitteln (wie die ebenfalls dreijährige Ausbildung etwa zum/zur Pferdewirt* in verdeutlicht, die sich, unterteilt in mehrere Spezialisierungen, um eine einzige Tierart dreht). Die Auszubildenden zum/zur Zootierpfleger*in durchlaufen zwar sämtliche „Reviere“ ihres Ausbildungszoos, in der Praxis bedeutet dies aber nicht viel mehr, als dass sie für jeweils ein paar Wochen in den verschiedenen Bereichen (Affen, Fische, Huftiere, Katzen, Reptilien, Vögel etc.) Hilfs- und Putzdienste verrichten. Sie erwerben im Zuge ihrer „Ausbildung“ im Betrieb allenfalls Grundkenntnisse in Futterzubereitung, Käfigreinigung und ordnungsgemäßer Betätigung von Schiebern. In der Tat sind Zootierpfleger*innen, eigenem Bekunden zufolge, die meiste Zeit des Tages mit „Karottenschnippeln“, „Scheißeschippen“ und „Umsperren“ beschäftigt (allein die Käfig- und Gehegereinigung umfasst 70 bis 80 Prozent des täglichen Arbeitspensums).
Hinzu kommt, dass die nunmehr dual und über drei Jahre hinweg Ausgebildeten in der Regel erst im dritten Lehrjahr zoospezifischen Berufsschulunterricht erhalten, die beiden ersten Lehrjahre werden sie gemeinsam mit Auszubildenden unterrichtet, die sich im dritten Lehrjahr auf die Tätigkeitsfelder „Forschung und Klinik“ sowie „Tierheim und Tierpension“ spezialisieren.3
Auch wenn die Gehälter „ausgelernter“ Zootierpfleger mit einer durchschnittlichen Bruttogrundvergütung zwischen 2800 und 3000 Euro (netto rund 1800 Euro) nicht eben üppig sind, machen die Personalausgaben den mit Abstand größten Anteil in der Betriebskostenrechnung eines Zoos aus. Der Zoo Duisburg beispielsweise wendet eigenen Angaben zufolge 52 Prozent seines jährlichen Budgets für die Gehälter seiner Angestellten auf (90 Festangestellte in Voll- und Teilzeit, davon 43 Tierpfleger*innen, sowie 30 Saisonkräfte; die restlichen 48% verteilen sich auf Abschreibungen und aurücklagen [13%], Reparaturen an Gehegen und Anlagen [10%], Verwaltung [7%], Wasser [6%], Tierfutter [5%], Energiekosten [4%], Werbung [2%] und Tierarztkosten [1%]). Viele Zoos versuchen insofern, an den Personalkosten zu sparen und drücken sowohl den Bestand als auch die Qualifikation des Pflegepersonals bis hart an die Grenze des eben noch Vertretbaren: in vielen Zoos werden an- oder ungelernte Hilfskräfte als „Tierpfleger“ beschäftigt, in einigen sogar mehrheitlich.
Unzureichender Pflegeschlüssel
Zoobetriebe sind in aller Regel personell heillos unterbesetzt. Der Pflegeschlüssel, der die jedem Tier pro Tag zugestandene Durchschnittspflegezeit ausweist, bewegt sich in den meisten Zoos im Bereich zwischen 1:90 und 1:150. Im niederbayerischen Tiergarten Straubing etwa werden die rund 2000 vorgehaltenen Tiere (aus 200 Arten) von 17 Pfleger*innen plus sechs Auszubildenden versorgt.4 Der Pflegeschlüssel liegt insofern (unter der Annahme, dass es sich um 17 Vollzeitstellen handelt und unter Berücksichtigung der Azubis als volle Arbeitskräfte) bei 1:135, was, konservativ berechnet (ohne Krankheits- bzw. sonstige Fehltage), eine durchschnittliche Brutto-Pflegezeit von dreieinhalb Minuten pro Tier und Tag bedeutet (einschließlich Futterzubereitung, Fütterung [teils mehrmals am Tag], Käfig-/Gehegereinigung, Wegezeiten etc.). Auch wenn Tiere unterschiedlicher Arten unterschiedliche Pflegeerfordernisse aufweisen und die Mithilfe von Praktikant*innen o.ä. nicht berücksichtigt ist, reicht die für jedes Tier veranschlagte bzw. zur Verfügung stehende Pflegezeit in keinem Falle hin zu einer auch nur ansatzweise tragfähigen Beobachtung, wie sie erforderlich wäre, um Befindlichkeitsstörungen oder sich abzeichnende Krankheiten rechtzeitig zu erkennen.
Allerdings würde auch ein erheblich verbesserter Pflegeschlüssel nicht notwendigerweise zu einer qualifizierteren Beobachtung und damit besseren Betreuung der Tiere führen: Zootierpfleger*innen sind qua Ausbildung zu einer strukturierten Verhaltensbeobachtung schlichtweg nicht befähigt. Am wenigsten sind sie in der Lage, psychische Belastungsstörungen, wie sie in der Haltung von Zootieren allgegenwärtig sind, zu erkennen, geschweige denn: fachlich angemessen damit umzugehen.
Unvergütete Praktika
Es passt ins Bild, dass große Teile der Pflegetätigkeit in den Zoos von Hospitant*innen und Praktikant*innen getragen werden, darunter eine Vielzahl junger Menschen, die ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) bzw. ein Berufsfindungs- und/oder Vorpraktikum absolvieren und dabei eine volle Arbeitskraft stellen. Insbesondere mit sogenannten Vorpraktikant*innen wird ein lukratives Geschäft gemacht: da das Berufsziel „Zootierpfleger*in“ unter Jugendlichen als ausgesprochen attraktiv gilt, werden die Zoos jährlich mit zahllosen Bewerbungen um die raren Ausbildungsplätze überflutet. Im Zoo Gelsenkirchen (=ZOOM Erlebniswelt) beispielsweise werden in der Regel zwei Ausbildungsplätze pro Jahr besetzt. „Um diese beiden Plätze“, so der Zoo, „bewerben sich – mit steigender Tendenz – bis zu 700 Interessenten“, die, um überhaupt ihre Unterlagen einreichen zu dürfen, ein „zwei bis dreiwöchiges Tierpflegepraktikum in der ZOOM Erlebniswelt“ zu absolvieren haben: „Der Eindruck, den die Bewerberin/der Bewerber beim Tierpflegepraktikum hinterlässt, ist von ausschlaggebender Bedeutung, um in die engere Auswahl zu kommen. (…) Das Praktikum wird nicht vergütet; auch können weder Fahrtkosten erstattet noch Unterkunft gewährt werden. Die Arbeitszeiten für Praktikanten/Praktikantinnen sind von Montag bis Freitag von 8.00 bis 16.00 Uhr mit einer Stunde Mittagspause. (…) Dieses Praktikum muss als erstes absolviert werden. Geeignete Kandidatinnen/Kandidaten werden danach (…) zum Wissenstest eingeladen. Erst mit den dann verbliebenen Kandidatinnen/Kandidaten werden (…) Vorstellungsgespräche geführt und die Endauswahl getroffen.“5 Sollten alle 700 Interessent*innen an den beiden Ausbildungsplätzen ein dreiwöchiges Praktikum absolvieren – ohne Praktikum keine Bewerbung –, entspricht das jährlich mehr als 70.000 unentgeltlich für den Zoo geleisteten Arbeitsstunden. (In anderen Zoos, Gettorf beispielsweise, müssen Ausbildungswillige gar vier Wochen unbezahlt arbeiten, um eine vage Chance auf ein Vorstellungsgespräch zu erhalten; mancherorts werden von den Praktikant*innen sogar Gebühren erhoben dafür, dass sie ein unvergütetes Praktikum ableisten dürfen.)
Das Auswahlverfahren garantiert zudem, dass letztlich die Angepasstesten unter den Bewerber*innen übrig bleiben, die sich selbst bei unzumutbarsten Arbeitsbedingungen, schlechtestem Betriebsklima und miserabelster Bezahlung nicht zur Wehr setzen. Während die „ZOOM Erlebniswelt“ von „physischer und psychischer Belastbarkeit“ spricht, die neben „Disziplin, Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit“ Auswahlkriterien für die Vergabe der Ausbildungsplätze seien, listet der Berufsverband der Zootierpfleger e.V. auf, was die Kandidat*innen bei der Ausbildung zum „Tierpfleger – Fachrichtung Zoo“ erwartet: „Körperlich schwere Arbeit bei jedem Wetter. Ihr steht mindestens 50 Tage im Jahr für 3–4 Stunden im Regen und versucht volle Schubkarren durch nassen Schlamm, Sand und Dreck zu schieben. Körperliche Fitness ist absolut erforderlich. Auch solltet Ihr mal die Zähne zusammenbeißen können. (…) Gestank – von Tieren (Ziegenbock), Kot, Futtertieren (Fisch) genauso wie Staub – von Heu/Stroh, Sägespäne, Sand, Fell, Federn. (…) Ein gewisses Ekelgefühl solltet Ihr unterdrücken können. (…) 98% der Wildtiere werden keinen direkten Kontakt zulassen. Deshalb beschränkt sich unsere Arbeit auf die Pflege der Tiere (Futter, Wasser, Beschäftigung!!!) und Reinigung sowie Instandhaltung der Anlagen mit Schaufel, Besen, Kratze, Schubkarre, Wasser, Schwamm, Lappen, Schrubber etc. Kleinreparaturen werden selbstverständlich ebenfalls von Euch durchgeführt. (…) Zur Ausbildung gehört auch das fachgerechte Abtöten einer Futterratte.“ Und nach dem Abschluss der Ausbildung: „Spätestens jetzt werdet Ihr in den vollen Schichtbetrieb integriert. Wochenende und Feiertage sind nun Arbeitszeit. Im Sommer kommen häufig Spätschichten dazu. Wenn mal ein Tier krank ist, müsst Ihr ebenfalls bleiben. So kann es sein, dass die zukünftige Familie Euch weniger zu Gesicht bekommt. (…) Aber habt Ihr es bis hier geschafft, ist es einer der schönsten Jobs der Welt !!!“6 (Tatsächlich erhalten die Auszubildenden weder in der ZOOM Erlebniswelt noch in einem der sonstigen Ausbildungszoos eine Übernahmegarantie; viele Zoos schließen eine Übernahme von vorneherein aus.)
Totale Fremdbestimmung
Zootierpfleger*innen, die sich ursprünglich vielleicht aus Zuneigung zum Tier diesem Beruf zugewandt hatten, werden schnell auf den Boden der Tatsachen geholt: „Rein emotionale Tierliebe“, so die Direktion des Nürnberger Tiergartens, sei in der Zootierpflege „fehl am Platz“; vielmehr sei der Beruf nur für jene geeignet, die den „objektiven Umgang mit Tieren“ [sic!] suchten.7 Sensibilität und Einfühlungsvermögen werden als unnötige Gefühlsduselei diffamiert und dem/der angehenden Zootierpfleger*in systematisch ausgetrieben; letzte Reste kommen im Arbeitsalltag abhanden.
Über die strukturelle Gewalt totaler Fremdbestimmung hinaus, die Zootierpfleger* innen über die von ihnen „betreuten“ Tiere ausüben, ist ihr direkter Umgang mit ihnen in aller Regel von eklatanter Missachtung ihrer Bedürfnisse gekennzeichnet, nicht selten auch von kaum fassbarer Rohheit. Der Dresdner Cheftierpfleger Jörg Burger beispielsweise züchtigte eine Elefantenkuh in derart brutaler Manier, dass eigentlich eine sofortige Kündigung aus dem Arbeitsverhältnis oder wenigstens eine Abmahnung zu erwarten gewesen wäre. Nichts dergleichen aber geschah, was darauf hindeutet, dass solcher Umgang mit Tieren innerhalb der Zoowelt als völlig „normal“ angesehen wird: Augenzeugenberichten zufolge hatte Burger die Elefantendame GUSTL, die ihn in einen Graben geschubst hatte, einem erbarmungslosen Bestrafungsszenarium unterzogen: „Mit knieenden Hinterbeinen und angewinkelten Vorderbeinen wurde GUSTL mit dem Elefantenhaken [=Schlagstock mit Eisenspitze und seitlich angebrachtem spitzem Haken] an ihren empfindlichsten Stellen durch Zufügung von Schmerzen bestraft. In einer minutenlangen Tortur setzte der Elefantenwärter den Haken mehrmals an.“8 (Dabei sind es die brutalen Unterwerfungs- und Strafmethoden selbst – an den Füßen angekettet werden die Tiere mit besagten Elefantenhaken, mit Eisenstangen oder elektrischen Viehtreiberstöcken an ihren sensibelsten Körperstellen [hinter dem Ohr, am Auge oder an den Geschlechtsteilen] gequält –, die immer wieder, auch zeitversetzt, zu Angriffen führen.)
Hinter den Kulissen
Praktikant*innen, die ein wenig „hinter die Kulissen“ der einzelnen Zoos blicken konnten, sprechen von gänzlich „seelenlosem“ Umgang mit den Tieren, seitens der Pfleger werde ihnen keinerlei erkennbare Sympathie oder Zuneigung entgegengebracht (worüber der aufgesetzt infantilisierende Ton, den manche Pfleger in Anwesenheit von Publikum anschlagen, nicht hinwegzutäuschen vermag). Selbst unzumutbarste und tierquälerischste Verhältnisse erregen nicht ihr Mitgefühl (schließlich wollen sie im Kollegenkreis nicht als „Tierknutscher“ verschrien werden). Eine Lehramtsstudentin, die für einige Zeit als Zoopädagogin tätig gewesen war, berichtet gar von tiefsitzender Abneigung einzelner Tierpfleger*innen gegen die von ihnen betreuten Tiere. Zitierter O-Ton einer Pflegerin: „Kaum hast du ihnen das Gehege hergerichtet, haben sie es schon wieder zugeschissen; ich könnte sie an die Wand nageln.“ Zootierpfleger*innen, so das Fazit der Pädagogin, „sind alles andere als Tierfreunde; sie waren es vielleicht einmal, der Zoo hat aus ihnen das Gegenteil gemacht. Zoologische Experten sind sie erst recht nicht: viele wissen nicht viel mehr von den Tieren, als was auf den Gehegeschildern steht.“9
Wesentlicher Bestandteil der systematischen Desensibilisierung der Zootierpfleger* innen ist die von ihnen geforderte Bereitschaft, eigenhändig sogenannte „Futtertiere“ zu töten. Im Zuge ihrer Ausbildung werden sie angeleitet, eigens gezüchteten „Futtertieren“ (Mäuse, Ratten, Hamster, Meerschweinchen, Kaninchen etc.) „fachgerecht“ den Schädel einzuschlagen bzw. ihnen das Genick zu brechen. (Das Töten eines „Futtertieres“ gilt als einem „vernünftigen Grunde“ dienend [=der Ernährung eines anderen Tieres] und ist, sofern „fachgerecht“ durchgeführt, gemäß § 17 Nr 1 TierSchG statthaft.)
Fachgerechtes Genickbrechen
Die Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz e.V. empfiehlt in einem eigenen Maßgabepapier, beim „Töten von Kleinsäugern zu Futterzwecken“ eines von drei „physikalischen Tötungsverfahren“ anzuwenden, nämlich: 1. den „Betäubungsschlag“ auf den Kopf mit einem Hammer o.ä., wobei das Tier unmittelbar anschließend durch Halsschnitt getötet und entblutet werden muss, 2. die „Dekapitation“, bei der dem zu tötenden Tier mit einem Messer o.ä. der Kopf abgetrennt wird, und 3, die „Zervikale Dislokation“, bei der „der Schädel [des zu tötenden Tieres] durch ein Instrument (z. B. Pinzette, Messerrücken, geschlossene Schere o.ä.) fixiert [wird], indem dieses am Hinterhauptsbein (zwischen 1. Halswirbel und Hinterkopf) angelegt wird. Dann wird das Tier ruckartig an der Schwanzbasis (ansonsten Gefahr des Schwanzabrisses) nach hinten oben (ca. 45-Grad-Winkel) gezogen.” Nicht angewandt werden sollten herkömmliche Methoden wie „Schlagen der Tiere über eine Kante oder Werfen auf den Boden“, bei denen „Treffsicherheit und damit sicherer Eintritt des Todes nicht gewährleistet“ werden könnten.10 Größere „Futtertiere“ wie Schafe oder Ziegen werden wie in der Metzgerei mit einem Bolzenschussapparat betäubt und dann geschlachtet. Größere Zoos verfügen zu diesem Zweck über eigene Schlachthäuser.
Die Fähigkeit, beim Töten von „Futtertieren“ zusehen zu können „ohne mit der Wimper zu zucken“, ist eines der entscheidenden Kriterien, um in die engere Auswahl für einen der begehrten Ausbildungsplätze zum/zur Zootierpfleger*in zu kommen. Vielfach wird das „Halslangziehen“ (=Genickbrechen) als eine Art „Initiationsritus“ inszeniert. (Erinnert sei an dieser Stelle an den ehemaligen Berliner Zoodirektor Bernhard Blaszkiewitz, der vor aller Augen vier Katzen höchstpersönlich das Genick brach. 11)
Dilettierende Tierärzt*innen
Weit mehr noch als das Pflegepersonal unterliegen die für und in Zoos tätigen Tierärztinnen und Tierärzte dem Problem, mit Tieren so vieler grundverschiedener Arten konfrontiert zu sein, dass sie für eine angemessene Versorgung jeder einzelnen Art unmöglich ausreichend qualifiziert sein können. Selbst die postgraduale Weiterbildung zum „Fachtierarzt für Zoo-, Gehege- und Wildtiere“ kann nicht einmal ansatzweise die Befähigung vermitteln, hunderte Arten von Gliederfüßern, Fischen, Amphibien, Reptilien, Vögeln und Säugetieren kompetent zu behandeln. Gleichwohl wird genau dies von Zootierärzt*innen verlangt, und gleichwohl behaupten diese, dies auch leisten zu können.
Der Tierarzt des Berliner Zoos André Schüle, zusammen mit einem Kollegen zuständig für die medizinische Betreuung von Tieren aus knapp 1500 Arten, verklärt die Unmöglichkeit, auch nur entfernt über die dafür notwendige Fachkenntnis,Erfahrung und Kompetenz verfügen zu können, zum besonderen Reiz seiner Arbeit, die ihn „täglich vor neue und ungeahnte Aufgaben“ stelle. Überdies reize es ihn besonders, „morgens nicht zu wissen, was heute passiert: Behandele ich einen Hai, einen Pfeilgiftfrosch, einen Adler oder einen Elefanten? Jeder Tag ist anders.“12
Auch der Zoo Dortmund betont wortreich die vielfältigen Aufgaben des Zootierarztes/ der Zootierärztin: „Operationen an Groß- und Kleintieren (…) Narkosen mit Gasen und Narkosemitteln, Geburtshilfe, Zahnbehandlungen, Behandlungen von Knochenbrüchen und Traumata, Röntgen- und Ultraschalluntersuchungen, Labortests von Blut-, Stuhl- und sonstigen Proben, Mikroskopische Untersuchungen, Infektionsbekämpfung, Injektionen und Teleinjektionen sowie das Sezieren verstorbener Tiere.“13 Zur Bewältigung der vorgenannten Aufgaben, sprich: für die medizinische Betreuung von rund 1500 Tieren aus knapp 200 Arten, gibt es im Zoo Dortmund eine einzige Tierarztstelle.
Schmalspurweiterbildung
Die in den 1950ern eingeführte Weiterbildung zum „Fachtierarzt für Zoo-, Gehege- und Wildtiere“ erstreckt sich berufsbegleitend über vier Jahre (die je nach Bundesland bei Vorliegen bestimmter Vorqualifikationen und Berufserfahrungen auf zwei Jahre reduziert werden können). In dieser Zeit, in der der angehende Fachtierarzt/die Fachtierärztin bereits eigenverantwortlich in einem Zoo arbeitet – Weiterbildungsvoraussetzung ist eine vierjährige Berufserfahrung –, erwirbt er/sie über den Besuch von Fachkongressen oder Fachfortbildungskursen mit einer Gesamtdauer zwischen 50 (z.B. Bayern14) und 160 Stunden (z.B. Baden-Württemberg15) Kenntnisse auf dem Gebiet 1. der tierärztlichen Prophylaxe im Zoo; 2. der medikamentellen Ruhigstellung einschließlich der Handhabung von Injektionswaffen und Injektionssystemen; 3. der Krankheiten und der Behandlung einschließlich der Chirurgie und Geburtshilfe (von: Menschenaffen, Affen, Halbaffen / Klein- und Großraubtieren / Meeressäugern / Elefanten / Einhufern / Paarhufern / Beuteltieren / Vögeln / Amphibien, Reptilien, Fischen) und 4. der Haltung von Zoo-, Gehege- und Wildtieren (Zoologische Grundkenntnisse / Haltung und Haltungsbedingungen / Fortpflanzung und Aufzucht / Ernährungsphysiologie und Fütterung / Tropische Tierkrankheiten). Eine nennenswerte Prüfung gibt es nicht, vielmehr wird lediglich ein Sachkundenachweis für den Umgang mit Narkosegewehren, der Nachweis einer wissenschaftlichen Publikation und gegebenenfalls eine Zusammenstellung einiger Fallberichte verlangt.16
Als ernstzunehmende Sonderqualifikation kann das alles nicht gelten, gleichwohl decken Zootierärzt*innen sämtliche Bereiche der Veterinärmedizin bei Tieren sämtlicher im Zoo gehaltenen Spezies ab. Angesichts des Umstandes, dass es für verschiedene Tierarten (Pferde, Rinder, Schweine, Kleintiere, Vögel, Fische etc.) eigene Facharztausbildungen gibt, die sich jeweils in verschiedene Teilgebiete gliedern (Chirurgie, Dermatologie, Innere Medizin, Kardiologie, Reproduktionsmedizin etc.) bzw. mit weiteren Spezialisierungen bzw. Zusatzbezeichnungen verbunden sind (Augenheilkunde, Zahnheilkunde etc.), und dass es darüber hinaus eigene Fachtierarztausbildungen für Klinische Laboratoriumsdiagnostik, Mikrobiologie (mit den Teilgebieten Bakteriologie und Mykologie sowie Virologie), Parasitologie, Pathologie, Pharmakologie und Toxikologie, Tierernährung und Diätetik, Tierhygiene, Epidemiologie etc. gibt, erscheint das Unterfangen, all dies in einer 50- bis 160stündigen Schmalspurweiterbildung erlernen und dann kompetent umsetzen zu wollen, von nachgerade irrwitziger Vermessenheit. Zootierärzt*innen dilettieren sich gewissermaßen von einem Patienten/einer Patientin zum/zur nächsten, wobei sie, im Gegensatz zu Humanmediziner*innen, für Fehldiagnosen oder Behandlungsfehler prinzipiell nicht haftbar gemacht werden können. Die extrem hohen Tierbestandsverluste in den einzelnen Zoos – jährlich bis zu 25 Prozent des Bestandes – sprechen eine deutliche Sprache.
Schlechter Witz
Erschwerend kommt hinzu, dass Zootierärzt*innen in der Regel mit einer nicht entfernt zu bewältigenden Vielzahl an Individuen konfrontiert sind. Die beiden oben erwähnten Tierärzte des Berliner Zoos sind für mehr als 20.000 Tiere (aus knapp 1500 Arten) zuständig, was eine Brutto-Behandlungszeit von rund 10 Minuten pro Tier und Jahr bedeutet. Rechnete man die von Zootierärzt*innen zu bewältigende Verwaltungs- und Bürotätigkeit mit ein – nach Auskunft verschiedener Veterinär*innen liege diese bei bis zu 80 Prozent ihrer Arbeitszeit –, reduziert sich die für jedes Tier veranschlagte Behandlungs-/Versorgungszeit auf ganze zwei Minuten pro Jahr (bzw. 10 Sekunden pro Monat). Einschließlich Wegezeiten. Wie allein die notwendigen Prophylaxemaßnahmen in dieser Zeit durchgeführt werden sollen (regelmäßige Impfungen sowie parasitologische und bakteriologische Kontrolle des Tierbestandes durch Kot- und Blutuntersuchung), bleibt unerschließlich; ganz zu schweigen von notwendigen Behandlungen bei Krankheit oder Verletzung. Um psychische Probleme bei den Tieren zu erkennen – Symptome von Hospitalismus etwa oder von Depression –, haben die Tierärzt*innen weder die erforderliche Zeit noch wären sie dazu befähigt (vielfach besteht, ähnlich wie beim Leitungs- und Pflegepersonal der Zoos, noch nicht einmal entsprechendes Problembewusstsein).
Auch wenn der medizinische Versorgungsschlüssel in anderen Zoos etwas günstiger ausfällt als in Berlin – im Zoo Heidelberg etwa liegt er nach obiger Berechnung bei immerhin knapp eineinhalb Minuten pro Tier und Monat –, kann er grundsätzlich nur als schlechter Witz gelten. In vielen Zoos bewegt sich die pro Tier vorgesehene tierärztliche Versorgungszeit im kaum mehr messbaren Bereich. Tatsächlich wird in den meisten Zoos hierzulande überhaupt kein festangestellter Tierarzt/keine festangestelle Tierärztin vorgehalten, vielmehr wird die Versorgung der Tiere von einem örtlich niedergelassenen Tierarzt/einer örtlich niedergelassenen Tierärztin gewissermaßen „nebenbei“ miterledigt. Bezeichnenderweise liegt der Haushaltsposten „Tierarzt“ in den einzelnen Zoos im unteren einstelligen Prozentbereich: der Zoo Duisburg beispielsweise wendet von seinem Jahresbudget in Höhe von 7,9 Millionen Euro gerade einmal ein Prozent für die tierärztliche Betreuung der knapp 9000 vorgehaltenen Tiere auf (zu denen mithin veterinärmedizinisch bzw. pharmakologisch intensiv zu betreuende Delfine zählen). Umgerechnet auf das einzelne Tier betragen die tiermedizinischen Ausgaben im Duisburger Zoo (einschließlich der Tierärzt*innenhonorare, der Laborkosten sowie sämtlicher Impfstoffe, Medikamente etc.) gerade einmal 2 Cent pro Tag.
Im Übrigen verfügen keineswegs alle in und für Zoos tätigen Tierärzt*innen über die oben beschriebene Facharztausbildung (was gesetzlich auch nicht vorgeschrieben ist): jeder approbierte Tierarzt/jede Tierärztin, mit oder ohne Facharztausbildung, kann und darf in einem Zoo arbeiten. Wie der im Nürnberger Zoo beschäftigte Veterinärmediziner Bernhard Neurohr ausführt: „Ich als Tierarzt muss genau wissen, welches Tier ich vor mir habe und auch da zählt die Erfahrung. Ich muss wissen, wie ich einen Hund behandle, um zu wissen, wie ich einen Wolf behandeln muss. Eine Katze, um zu wissen, wie ich einen Löwen behandle. Oder ein Pferd, damit ich weiß, was ich mit einem Zebra machen muss. Es ist also gut, schon einschlägige Erfahrung als Tierarzt mitzubringen, wenn möglich aus einer Landpraxis. Denn dort hat man Erfahrung mit Klein- und Großtieren. Also nicht nur mit Hund und Katze, sondern am besten auch mit Rind, Ziege, Schaf, Pferd und Schwein. Das ist von großem Vorteil und hilft bei der Arbeit in einem Zoo enorm.“17 Das Gros der in und für Zoos tätigen Tierärzt*innen verfügt über keine zootierspezifische Facharztausbildung. Insgesamt gibt es in Deutschland mit seinen mehr als 860 Zoos und zooähnlichen Einrichtungen weniger als 100 „Fachtierärzte für Zoo-, Gehege- und Wildtiere“.
Mangelhafte Hygienestandards
Ein bezeichnender Missstand herrscht in dem angeblich nach wissenschaftlichen Maßstäben geführten Tiergarten Straubing (Niederbayern)18, der rund 2000 Tiere aus 200 Arten vorhält. Die veterinärmedizinische Betreuung dieser Tiere obliegt dem Tierarzt Dr. Franz Able, der im Hauptberuf als Veterinäramtsleiter zugange und insofern für Verbraucherschutz und Lebensmittelkontrolle des Landkreises zuständig ist: „Einmal in der Woche“, so der Zoo auf seiner Website, „sieht er [=Able] im Straubinger Tiergarten nach dem Rechten“19 Konservativ berechnet sind insofern für jedes Tier des Straubinger Zoos 15 Sekunden tierärztlicher Betreuung pro Monat veranschlagt (einschließlich Wegezeiten und Vor- bzw. Nachbereitung).
Es versteht sich, dass im Tiergarten Straubing, wie in den meisten anderen Zoos auch, keine Veterinärstation vorgehalten wird: notwendige Behandlungen, einschließlich chirurgischer Eingriffe, werden direkt in den Gehegen, Käfigen oder Ställen der jeweiligen Tiere vorgenommen, wobei von der Einhaltung wenigstens grundlegender Hygienestandards keine Rede sein kann. OP-Säle und/oder Quarantänestationen gibt es nur in ein paar wenigen Großzoos, und auch da erst seit wenigen Jahren.
Nicht selten, wie im Falle des Dr. Able, sind Zootierarzt/-ärztin und Amtstierarzt/-ärztin ein und dieselbe Person, so dass über Verstöße gegen das Tierschutzgesetz, für dessen Einhaltung die Amtstierärzt*innen zuständig sind, oftmals wohlwollend hinweggesehen wird: der Amtstierarzt/die Amtstierärztin müsste ansonsten gegebenenfalls gegen sich selbst ermitteln. Gelegentlich wechseln Zootierärzt*innen auch direkt in die Amtsstube, wie zum Beispiel der langjährige Krefelder Zooveterinär Martin Straube, der in unmittelbarem Anschluss an seine Tätigkeit im Zoo auf den Sessel des Amtsveterinärs berufen wurde. Es verwundert insofern nicht, dass angezeigte Missstände in Zoos von den zuständigen Veterinärbehörden meist nur zögerlich, wenn überhaupt, verfolgt werden. Selbst eine katastrophale Einrichtung wie der Zoo Lübeck erhielt über Jahre hinweg immer wieder die Betriebsgenehmigung verlängert, bis endlich – vor dem Hintergrund massiven Drucks von außen – eine Schließung verfügt wurde.20 Fälle, in denen Veterinärbehörden „von sich aus“ gegen Missstände in einem Zoo tätig geworden wären, sind nicht bekannt.
1 Der vorliegende Beitrag stellt die überarbeitete Version eines Vortrages dar, den der Autor auf dem 5. Tierschutzseminar des Bundesverbandes der Veterinärmedizinstudierenden in Deutschland (bvvd e.v.) an der Universität Leipzig gehalten hat (21.–23.6.2019)
2 www.gesetze-im-internet.de/tierpflausbv_2003/BJNR109300003.html
3 https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung/ausbildungsaufbau&dkz=532
4 www.tiergarten-straubing.de/index.cfm?resid=1&res=1024&sid=2&skt=4789&suid=
21&pid=0&id=10416
5 www.zoom-erlebniswelt.de/deutsche_Version/Unternehmen/Jobs/Ausbildung_Tierpfleger.asp
6 www.zootierpflege.de/berufsbild.html
7 Tiergarten Nürnberg (Hrsg.): Der Wegweiser durch den Tiergarten Nürnberg (Besucherbroschüre). Nürnberg, 2011, S.149
8 Tierrechtsgruppe Dresden: Der Dresdner Zoo: Zynismus in Reinform oder die Lobpreisung der Schande. in: http://tierbefreiung-dresden.org/wp-content/uploads/2014/08/Zoo-Reader.pdf
9 Die ehemalige Zoopädagogin und heutige Gymnasiallehrerin will aus naheliegenden Gründen namentlich nicht genannt werden. Ihre Aussage ist gleichwohl verbürgt.
10 www.tierschutz-tvt.de/alle-merkblaetter-und-stellungnahmen/?no_cache=1&download=TVTStellungn._T%C3%B6ten_Kleintiere_zu_Futterzwecken__Apr._2011_.pdf&did=97
11 www.berliner-zeitung.de/archiv/der-tierparkchef-toetet-eigenhaendig-vier-kaetzchen--nur-seinaufsichtsrat-zeigt-verstaendnis-tierschutz---la-blaskiewitz,10810590,10548476.html
12 www.hundkatzepferd.com/archive/595298/Zoo-Interview-mit-Dr.-Andr%C3%A9-Schuele.html
13 www.dortmund.de/de/freizeit_und_kultur/zoo_dortmund/nachrichten_zoo/nachricht.jsp?nid=260628
14 www.bltk.de/fileadmin/user_upload/Tieraerzte/Weiterbildung/WBO-2003/Anlage_I/40-ftazootiere.pdf
15 www.ltk-bw.de/files/LTKBW/03_Tieraerzte/Weiterbildung/WBGaenge/Zoo,%20Gehege,%
20Wildtiere_ab_2009.pdf
16 www.tieraerztekammer-sachsen.de/dokumente/WBO-Anlage/Fachtierarzt-fuer-Zoo-Gehege-und-Wildtiere.pdf
17 www.wasistwas.de/natur-tiere/die-themen/artikel/link//ec6efcf52a/article/wie-wird-man-tierarzt-imzoo.html
18 www.tiergarten-straubing.de/
19 www.tiergarten-straubing.de/index.cfm?resid=1&res=1200&sid=2&skt=783&suid=21&pid=947
&id=2631[Nach öffentlich vorgetragener Kritik verschwand der Eintrag zu Dr. Ables Tätigkeit im Zoo aus dem Netz.]
20 vgl. www.welt.de/print-welt/article526236/Tierschuetzer-Luebecker-Zoo-muss-geschlossen-werden.html