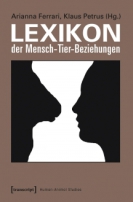Lexikon GAP
Arianna Ferrari / Klaus Petrus (Hg.)
LEXIKON der Mensch-Tier-Beziehungen
Bielefeld 2015
Great Ape Project
Allgemeines: Das Great Ape Project, initiiert 1993 von den PhilosophInnen Cavalieri und Singer, beinhaltet die Forderung, die Großen Menschenaffen – Schimpansen, Gorillas, Orang Utans und Bonobos – aufgrund ihrer großen genetischen Ähnlichkeit mit dem Menschen und ihren ähnlich komplexen kognitiven, affektiven und sozialen Fähigkeiten bestimmte Grundrechte zuzuerkennen, die bislang dem Menschen vorbehalten sind: Das Grundrecht auf Leben, auf individuelle Freiheit und auf körperliche wie psychische Unversehrtheit (Cavalieri/Singer 1994). Dadurch sind praktisch alle Fälle erfasst, die Menschenaffen in Bezug auf Menschen betreffen können: ® Jagd, Wildfang, ® Zirkus, ® Zoo, ® Tierversuche sowie Zerstörung ihrer Lebensräume. Es solle den Großen Menschenaffen der gleiche moralische und gesetzlich zu schützende – das heißt: auch einklagbare – Rechtsstatus einer ® Person zukommen, der allen Menschen zukommt. Singer und Cavalieri, dazu eine Reihe renommierter Wissenschaftler wie Bekoff, Dawkins, Francione, Goodall oder Regan, wiesen überzeugend nach, dass die überkommene Ungleichbehandlung von Menschen und Menschenaffen im Lichte wissenschaftlicher Erkenntnis nicht länger haltbar und damit moralisch zu verwerfen ist (® Tierphilosophie).
Enge Verwandtschaft: Seit den 1960ern wurden Unmengen ethologischer Befunde und Erkenntnisse über das Leben Großer Menschenaffen in ihren natürlichen Lebenszusammenhängen gesammelt. Forscherinnen wie Goodall (Schimpansen), Diane Fossey (Gorillas) und Biruté Galdikas (Orang Utans) zeichneten ein völlig neues Bild der engsten Verwandtschaft des Menschen. Viele der Vorstellungen, wie sie bis dahin in Umlauf waren, mussten revidiert werden, manche sogar in ihr komplettes Gegenteil. Große Menschenaffen verfügen, wie sich zeigte, über tradierte Formen von Kultur, einschließlich der Fähigkeit, Werkzeuge herzustellen oder bei Krankheiten bestimmte Heilkräuter einzusetzen, sie haben ® Selbstbewußtsein samt einer Vorstellung von Vergangenheit und Zukunft, sie können vorausschauend denken und planen, empfinden Freude, Trauer, Leid und Mitgefühl und haben einen ausgeprägten Sinn für Humor (® Geist der Tiere). Ihre kognitiven Fähigkeiten unterscheiden sich von denen des Menschen allenfalls graduell; entsprechend trainiert können sie über Gesten und Handzeichen aus der Gehörlosensprache oder über sog. Lexigramme (= abstrakte Symbole auf einer Computertastatur) komplexe Sachverhalte verstehen und ausdrücken (® Sprache). Naturwissenschaftlich besehen ist es daher völlig unhaltbar, überhaupt noch zwischen Menschen und Menschenaffen zu unterscheiden: Die Erbgutunterschiede etwa zwischen Mensch und Schimpanse bewegen sich je nach Meßmethode im minimalen Prozent- oder gar nur im Promillebereich. Schon allein deshalb ist es unabweisbar, den Großen Menschenaffen die eingeforderten Grundrechte zuzugestehen (® Tierrechte).
Selbstredend geht es dabei nicht um die Zuerkennung umfassender Menschenrechte gemäß der Charta der Vereinten Nationen – es wäre dies eine absurde Forderung, da zu den unveräußerlichen Menschenrechten mithin Gewissens- und Religionsfreiheit zählt, die für die Großen Affen ebenso irrelevant ist wie Berufsfreiheit, das Recht auf Arbeit oder das Recht auf Gründung von Gewerkschaften. Vielmehr stehen Grundrechte zu Debatte, die für Menschen und Menschenaffen gleichermaßen relevant sind und auf die Menschen und Menschenaffen gleichermaßen moralischen Anspruch haben, die bislang aber nur für Menschen gelten.
Die Forderung nach elementarer Gleichstellung der Großen Menschenaffen setzt einen Entwicklungsverlauf fort, der allgemein in der Menschheitsgeschichte erkennbar ist: Nach Nationalismus, Rassismus, Ethnozentrismus und Sexismus ist der historische Moment gekommen, auch die Schranke des ® Speziesismus zu überwinden, der die Diskriminierung von Lebewesen allein aufgrund ihrer Artzugehörigkeit rechtfertigt. Wie im Falle »unmündiger« Menschen, die nicht für sich selbst sprechen und ihre Rechte nicht selbst formulieren können, sollten Rechtsansprüche von Großen Menschenaffen durch Sachwalter vertreten werden können.
Tierrechtskontroverse: In Tierrechtskreisen wird das Great Ape Project seit je kontrovers diskutiert: durch den allfälligen Einbezug der Großen Menschenaffen in die Rechtsgemeinschaft der Menschen, so die Argumentation der Kritiker, verschöbe sich nur die Grenzlinie, so dass nun Menschen und Große Menschenaffen auf der einen von allen anderen Tieren auf der anderen Seite getrennt würden. Das Gros der Tiere bezöge hieraus keinerlei Nutzen (vgl. ® Tierbefreiung; ® Posthumanismus).
Tatsächlich ist die vermeintliche Bevorzugung von Gorilla, Orang Utan & Co ausschließlich in pragmatischen bzw. strategischen Überlegungen begründet: Es gibt gerade bei den Großen Menschenaffen – weniger als bei jedem anderen Tier – kein ethisch haltbares Argument, ihnen Rechte vorzuenthalten, die jedem Menschen ganz selbstverständlich zustehen. Singer schreibt dazu: »Der Schritt hin zu einer Aufnahme aller empfindungsfähigen Wesen in die Gemeinschaft der Gleichen ist zur Zeit noch unmöglich. So stark die ethischen Argumente auch sein mögen, ist die Ausbeutung von nichtmenschlichen Tieren (...) doch zu selbstverständlich, zu weit verbreitet und ökonomisch lukrativ, als dass ihre Versklavung innerhalb absehbarer Zeit ein Ende finden würde« (Singer 1996: 402) Das Great Ape Project schaffe eine Möglichkeit, die »moralische Gemeinschaft über die menschliche Spezies hinaus hier und jetzt zu erweitern«. Die Menschenaffen könnten insofern zu Pionieren werden: »Ist erst einmal anerkannt, dass es auch jenseits unserer Speziesgrenze Wesen gibt, die einen berechtigten Anspruch darauf haben, in die Gemeinschaft der Gleichen aufgenommen zu werden, so wird dies zweifellos einen Durchbruch in unserem Denken bedeuten. Dieser Riß in der Speziesbarriere wird in seiner Bedeutung weit über die Großen Menschenaffen hinausreichen« (Singer 1996: 399f.).
Hetzkampagne: Nach ersten Erfolgen – 1999 verbot Neuseeland per Gesetz sämtliche invasiven Experimente an Menschenaffen, gefolgt wenig später von der Inselgruppe der Balearen, die einen umfassenden Schutz der Menschenaffen verfügte – verlor das Great Ape Project im Jahre 2008 fast schlagartig sein bis dahin aufgebautes Momentum. Der Grund dafür lag in der Entwicklung, die das Projekt in Spanien genommen hatte: Eine parlamentarische Initiative mit dem Ziel, den besonderen Status der Großen Menschenaffen legislativ anzuerkennen, war unmittelbar vor ihrem Durchbruch noch auf ganzer Linie gescheitert. Die spanische Regierung unter dem seinerzeitigen Ministerpräsidenten José Luis Zapatero (Sozialistische Arbeiterpartei) war letztlich vor der mächtigen katholischen Kirche des Landes eingenickt, die in einer beispiellosen Hetzkampagne von sämtlichen Kanzeln herunter dagegen zu Felde gezogen war. Unter Verweis auf die »Gottebenbildlichkeit des Menschen« schloß etwa Bischof José Ignacio Munilla Aguirre (Palencia) allein den Gedanken an eine Einbeziehung von Nicht-Menschen in die Gemeinschaft der Gleichen als »antichristliche Verschwörung« und »Rebellion gegen die christliche Anthropologie, gegen Vernunft und Natur« aus (Remele 2012).
Der grüne Abgeordnete Francisco Garrido, der den Entschließungsantrag in das Parlament eingebracht und die Initiative maßgebend vorangetrieben hatte, kommentierte die Einflussnahme der Kirche so: »Für unsere Forderungen werden wir kritisiert wie einst die Suffragetten, als sie das Wahlrecht für Frauen wollten, oder die Gegner der Sklaverei, die das Ende der Leibeigenschaft forderten« (Kulturzeit 2006).
Auch im deutschsprachigen Raum zählt die katholische Kirche zu den erbittertsten Gegnern des Projekts. Selbstredend sprechen sich auch Zoobetreiber und sonstige Profiteure der Gefangenhaltung von Wildtieren entschieden gegen das Great Ape Project aus, vorneweg Jörg Junhold, Direktor des Zoos in Leipzig und zugleich Präsident des Weltzooverbandes WAZA, der kundtut, Menschen und Menschenaffen seien viel zu unterschiedlich, als dass ihnen ähnliche oder gar gleiche Rechte zuerkannt werden könnten.
Relaunch: Im Jahr 2011 hat die in Oberwesel ansässige Giordano-Bruno-Stiftung, ein Zusammenschluß von Wissenschaftlern, Publizisten und Kulturschaffenden im Leitbild von Aufklärung und evolutionärem Humanismus, mit der Verleihung ihres Ethikpreises an Cavalieri und Singer (in Anerkennung ihres langjährigen Einsatzes für ® Tierrechte und insbesondere für ihre Initiierung des Great Ape Project) den Faden wieder aufgegriffen (Giordano Bruno-Stiftung 2012). Mit einer Gesetzesinitiative auf nationaler Ebene (Erweiterung des Grundgesetzes in Artikel 20a, analog zur Aufnahme des Tierschutzes in den gleichen Artikel im Jahre 1993) sowie einer breitangelegten Untersuchung der Haltungsbedingungen Großer Menschenaffen in deutschen Zoos wurde das Projekt zu neuem Leben erweckt, das von einer Vielzahl namhafter Tierschutz- und Tierrechtsorganisationen unterstützt wird (Goldner 2014).
Colin Goldner
Literatur
Cavalieri, P./Singer, P. (Hg.) (1994): Menschenrechte für die Großen Menschenaffen, Hamburg.
Giordano Bruno-Stiftung (Hg.) (2012): Grundrechte für Menschenaffen, Aschaffenburg.
Goldner, C. (2014): Lebenslänglich hinter Gittern, Aschaffenburg.
Remele, K. (2012): »Von Hermelinen, Menschen und Gott: Christliche Tierethik«. in: E.Riether/M.N. Weiss, Tier-Mensch-Ethik, Münster.
Kulturzeit (2006): »Menschenrechte für Menschenaffen«, in: 3SAT vom 8.6.2006.
Singer, P. (1996): Animal Liberation / Die Befreiung der Tiere, Reinbek.
Zum Weiterlesen
Benz-Schwarzburg, J. (2012): Verwandte im Geiste – Fremde im Recht, Erlangen.
Berliner Tierrechts-Aktion (Hg.) (2007): Befreiung hört nicht beim Menschen auf!, Reiskirchen.
Brensing, K. (2013): Persönlichkeitsrechte für Tiere, Freiburg.
Cavalieri, P. (2002): Die Frage nach den Tieren, Erlangen.
Nakott, J. (2012), »Wie du und ich: Grundrechte für Menschenaffen«, in: National Geographic 7, S.38-71.