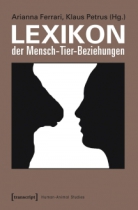Lexikon "Zoo"
Arianna Ferrari / Klaus Petrus (Hg.)
LEXIKON der Mensch-Tier-Beziehungen
Bielefeld 2015
Zoo
Geschichte: Rund 3.000 Zoos und zooähnliche Einrichtungen (Wild-, Safari-, Freizeitparks etc.) gibt es derzeit in Europa, in denen gegen Entgelt Wildtiere zur Schau gestellt werden. Mit mehr als 860 davon weist Deutschland die größte Dichte auf, in Österreich und in der Schweiz gibt es je 85. (Weltweit sind mehr als 10.000 derartiger Einrichtungen registriert.) Im Durchschnitt werden pro Zoo etwa 2.500 Tiere aus 250 Arten gehalten.
Die erste größere Tiersammlung der abendländischen Welt war 1220 am sizilianischen Hof Friedrichs des II. entstanden, gefolgt 1235 von einer königlichen Menagerie im Tower of London. Ab Mitte des 16. Jhs. legten sich v.a. italienische Fürsten und Fürstbischöfe Menagerien zu; eine der berühmtesten, neben der der Medici in Florenz, ließ sich ab 1610 Kardinal Scipione Borghese in Rom einrichten. Die älteste heute noch bestehende Tiersammlung wurde 1542 unter Kaiser Ferdinand I. in Schönbrunn bei Wien begründet. Zur bedeutendsten Menagerie ihrer Zeit stieg die ab 1662 unter Ludwig XIV. im Schlosspark von Versailles eingerichtete Ménagerie auf; vergleichbare Anlagen, verbunden meist mit Jagdgattern, entstanden ab 1680 auch an anderen europäischen Höfen. 1789 wurde die Tiersammlung in Versailles aufgelöst. Die Tiere wurden in eine neugeschaffene öffentliche Ménagerie im Pariser Jardin des Plantes überführt, die als Modell für eine Vielzahl weiterer Zoogründungen in ganz Europa diente. Im Gegensatz zu den fürstlichen Ménagerien sahen sie sich naturwissenschaftlicher Forschung verpflichtet. Der erste dieser Bürgerzoos wurde 1828 in London begründet. 1844 wurde in Berlin der erste »deutsche« Tiergarten eröffnet, gefolgt von Zoos in Frankfurt/M., Köln, Dresden, Hamburg, Hannover und Karlsruhe. Bis zur Jahrhundertwende wurden in all jenen Ländern, die als Kolonialmächte unbegrenzten Zugriff auf Nachschub an Wildtieren hatten (England, Russland, Frankreich, Dänemark, Portugal, Spanien, die Niederlande, ab 1871 auch das Deutsche Kaiserreich) nicht weniger als dreißig weitere Großzoos etabliert. Außerhalb Europas gab es nur sehr vereinzelt Zoogründungen, die meisten davon entstanden in den Kolonialländern selbst, aus denen die Wildtiere für die europäischen Zoos bezogen wurden und die insofern als Sammel- und Umschlagplätze dienten (z.B. Melbourne, Djakarta, Pretoria). Auch in den USA wurden mehrere Großzoos begründet. Auch nach der Jahrhundertwende setzten sich die Zoogründungen ungebrochen fort. Allein im Deutschen Reich wurden bis zu Beginn des Ersten Weltkrieges fünf weitere Großzoos (z.B. Halle, Nürnberg, München) sowie zahlreiche kleinere Tiergärten, Schaugehege und Aquarien eingerichtet.
Waren die Zoos des ausgehenden 19. Jhts. in erster Linie Vergnügungsstätten für das »bessergestellte« Bürgertum gewesen – Naturwissenschaft spielte schon seit den 1860ern nur noch eine randständige Rolle –, leitete sich mit dem ab 1874 in Hamburg eingerichteten »Thierpark« des Tierhändlers Carl Hagenbeck ein Wandel hin zur Öffnung der Zoos für ein Massenpublikum ein. Hagenbeck verknüpfte die Zurschaustellung exotischer Wildtiere mit ® Zirkus- und Rummelplatzattraktionen. Da er zudem die Eintrittspreise auf ein Niveau absenkte, das auch »kleinen Leuten« den Besuch seiner Tierschauen erlaubte, erzielte er ungeheueren Publikumszuspruch. Von Anfang an veranstaltete er auch sog. »Völkerschauen«. Er importierte »exotische Menschen« aus allen Teilen der Welt, bevorzugt aus Äthiopien, Somalia, dem Sudan und anderen als »rückständig« geltenden Ländern und Kulturen, die er, oft unter falschen Versprechungen, von Agenten anwerben und nach Hamburg verschiffen ließ. Meist waren die Gruppen eine Saison lang bei Hagenbeck zu besichtigen, dann wurden sie an andere Zoos und Kolonialschauen weitervermietet. Derlei kulturchauvinistische und rassistische »Völkerschauen« fanden bis herauf in die 1930er in zahlreichen Zoos statt (z.B.Leipzig, Frankfurt/M., Köln, Münster).
Mit Ausbruch des Ersten Weltkrieges gerieten viele der Zoos in massive wirtschaftliche Schräglage, auch nach dem Krieg übten sie nur wenig Anziehungskraft aus. Erst ab 1933 ging es wieder aufwärts. Großzügig gefördert durch die neuen Machthaber konnten heruntergekommene Anlagen instandgesetzt bzw. durch Neubauten ersetzt werden. In zahlreichen Städten wurden mit finanzieller und propagandistischer Unterstützung der Nationalsozialisten neue Zoos eingerichtet (z.B. Heidelberg, Osnabrück, Krefeld). Folgerichtig waren praktisch alle Direktoren und Verwaltungsräte deutscher Zoos spätestens seit 1937 Mitglieder der NSDAP oder gehörten sonstigen Gliederungen des NS-Staates an. Während des Zweiten Weltkrieges wurden viele Zoos schwer beschädigt. Nach dem Krieg zählte ihre Wiederherstellung vielerorts zu den ersten in Angriff genommenen Aufbaumaßnahmen. Schon wenige Jahre nach Kriegsende wurden in vielen Großstädten weitere Zoos begründet (z.B. Magdeburg, Stuttgart, Dortmund), hinzu kamen hunderte kleinerer Kommunen, v.a. in der DDR, die eigene Zoos und Wildparks anlegten. Die Welle ebbte erst Anfang der 1970er etwas ab (Goldner 2014).
Kritik: Während Zoos sich seit je in einem von Kritik weitgehend unangetasteten Freiraum bewegen konnten, gerieten sie Mitte der 1970er unter massiven Rechtfertigungsdruck. Im Zuge des Washingtoner Artenschutzübereinkommens (CITES) von 1973, das den bis dahin völlig unkontrollierten Handel mit vom Aussterben bedrohten Tierarten erheblich einschränkte, trat erstmalig ins öffentliche Bewusstsein, welch enormen Anteil die für Zoos getätigten Wildfänge daran hatten, dass viele dieser Tierarten überhaupt erst an den Rand des Aussterbens gebracht worden waren (® Artenschutz; ® Exotisches Heimtier).
In Italien bildete sich eine breite Front an ZoogegnerInnen, die zur Schließung zahlreicher Zoos führte (Sanna 1992). Eine ähnliche Entwicklung gab es in England (McKenna et al. 2000). Vor dem Hintergrund der anhaltenden Kritik und insofern drohender BesucherInnenrückgänge suchten viele Zoos mit hektisch in Angriff genommenen Um- und Neubaumaßnahmen, die eklatantesten Missstände zu beseitigen bzw. publikumswirksam zu kaschieren (Austermühle 1996). Parallel dazu wurde eine kollektive Abwehrstrategie gegen Kritik von außen entwickelt. Der »moderne Zoo« wird seither als auf »vier Säulen« stehend präsentiert: Bildung, Artenschutz, Forschung und Erholung. Zur Verankerung der neukonstruierten Selbstlegitimation in den Köpfen der Menschen wurde über zahllose TV-Doku-Soaps eine gigantische Propagandaoffensive gestartet.
Tatsächlich hält keine der vier Säulen einer Überprüfung stand. Der Zoo ist gerade kein Lernort, an dem Naturverständnis entwickelt wird. Vielmehr werden die Besucher systematisch dazu angeleitet, die in Käfigen und Betonbunkern vorgeführten Zerrbilder, Klischees und Karikaturen von ® Natur als Natur selbst zu verkennen. Ebendeshalb fällt ihnen das ® Leiden der eingesperrten, ihrer ® Freiheit und ® Würde beraubten Tiere nicht auf: sie lernen, das Widernatürliche als das Natürliche zu sehen (Jamieson 2006).
Die Behauptung, Zoobesucher würden durch das Kennenlernen gefangengehaltener Tiere für deren freilebende Artgenossen sensibilisiert und sich folglich für Arten-, Natur- und Umweltschutz einsetzen, ist absurd. Der Hype etwa um Eisbär Knut hat mit Blick auf den Schutz von Eisbären und ihrer Lebensräume überhaupt nichts bewirkt.
Das 1985 eingerichtete Europäische Erhaltungszuchtprogramm (EEP), das bedrohte Arten durch Nachzucht im Zoo vor dem Aussterben bewahren will, umfasst derzeit 189 Spezies, d.h. gerade einmal 3.5% der von CITES gelisteten Arten. Selbst wenn die v.a. auf publikumattraktive Arten ausgerichtete Erhaltungszucht positiv zu werten wäre, ließe sich damit nicht die Gefangenhaltung von Tieren nicht bedrohter Arten rechtfertigen, die das Gros des Besatzes in Zoos ausmachen. Im Durchschnitt fallen nur 8% der jeweils vorgehaltenen Arten unter eines der EEP-Programme, für allen anderen kann das vielzitierte »Arche-Noah«-Argument nicht herangezogen werden. Dennoch wird ihre Gefangenhaltung damit legitimiert. Ernstzunehmende Auswilderungs- oder Wiederansiedelungsprojekte gibt es nur für ein paar wenige der über EEP nachgezüchteten Arten (z.B. Przewalskipferd, Alpensteinbock, Wisent, Gänsegeier). Für die Mehrzahl ist eine Auswilderung weder vorgesehen noch möglich (Goldner 2014).
Das Forschungsinteresse der Zoos richtet sich in erster Linie auf zoospezifische bzw. rein innerbetriebliche Belange. Zudem forschen die Zoos in der Regel gar nicht selbst, vielmehr werden studentische Projekt-, Haus- oder Abschlussarbeiten als Ausweis eigener Forschertätigkeit reklamiert. Der über den Zoo hinausreichende wissenschaftliche Wert der jeweiligen Arbeiten ist denkbar gering.
Auch wenn viele Menschen den Besuch eines Zoos als Freizeitvergnügen und Erholung empfinden, ist die lebenslange Gefangenhaltung leidensfähiger Individuen damit nicht zu rechtfertigen (ebensowenig wie Parforcejagden, Stierkämpfe oder Rodeos damit zu rechtfertigen sind, dass es immer noch Menschen gibt, die Vergnügen an derlei Tierqualveranstaltungen haben). Zoos sind immer »Schauveranstaltungen auf Kosten der tierischen Zwangsdarsteller« (Sommer 2013: 144).
Colin Goldner
Literatur
Austermühle, S. (1996): »… und hinter tausend Stäben keine Welt!« Die Wahrheit über Tierhaltung im Zoo, Hamburg.
Goldner, C. (2014): Lebenslänglich hinter Gittern, Aschaffenburg.
Jamieson, D. (2006): »Against Zoos«, in: P. Singer (Hg.), In Defense of Animals: The Second Wave, Malden, S. 132-143.
MacKenna, V et al. (Hg.) (2000): Gefangen im Zoo, Frankfurt/M.
Sanna, E. (1992): Verrückt hinter Gittern, Reinbek.
Sommer, V. (2013): »Tierethik: Menschenrechte für Menschenaffen?«, in: GEO 33, S. 144.
Zum Weiterlesen
Batten, P. (1976): Living Trophies, New York.
Born Free Foundation (2012): The EU Zoo Inquiry 2011, Horsham.
Bostock, S. (2007): Zoos and Animal Rights, London.
Goschler, E./Orso, F. (2006): Der Zoowahnsinn von A-Z, Salzburg.
Jensen, D./Tweedy-Holmes, K. (2007): Thought to Exist in the Wild, Santa Cruz.
Panthera Projektgruppe (Hg.) (1994): Der Zoo, Göttingen.
Schalk, E.-M. (2001): Lebenslänglich, Salzburg.
Schneider, E. et al. (1989): Die Illusion der Arche Noah, Wiesbaden.