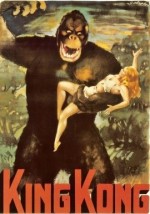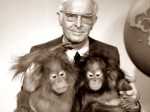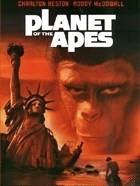Kulturgeschichte
Wodurch genau wird eigentlich die Sicht des Durchschnittsbundesbürgers auf die Großen Menschenaffen geprägt?
von Colin Goldner
Schimpansen, auch ihre kleineren Verwandten, die Bonobos, gelten als Sympathieträger schlechthin. Man kennt sie aus dem Zoo oder dem Zirkus, wo sie als die geborenen Spaßmacher erscheinen, in letzterem oft kostümiert mit Röckchen oder Livree.
Ältere Semester erinnern sich vielleicht noch an den berühmten Schimpansen Petermann aus dem Kölner Zoo, dem man mehr als dreißig Jahre lang eine bunte Gardeuniform anzog, damit er bei Karnevalssitzungen der umjubelte Star des Elferrates sein konnte. Mitte der 1980er brach Petermann eines Tages aus seinem Käfig aus. Auf seiner Flucht biß er dem öffentlich eher unbeliebten Zoodirektor Günther Nogge, der ihn aufhalten wollte, ein Ohr und mehrere Finger ab, was ihm noch mehr Sympathien einbrachte. Als er letztlich von der Polizei erschossen wurde, avancierte er zur unangefochtenen Legende des Kölner Karnevals. Bis heute gilt Petermann als Inbegriff rheinischen Humors.
Im niederbayerischen Straubing gab es in den 1960ern einen Schimpansen namens Jimmy, den der damalige Zoodirektor Hans Schäfer regelmäßig ins Caféhaus in die Straubinger Innenstadt mitnahm, wo er ihn zum Gaudium der anderen Gäste Bier trinken und Zigarren rauchen ließ (vgl. hier)
Solcherart Umgang mit Schimpansen gehört glücklicherweise, hierzulande wenigstens, der Vergangenheit an. Nach wie vor indes werden Menschenaffen auch hierzulande in Zoos und Tiergärten zur Schau gestellt, eingesperrt hinter Elektrozäunen, Eisengittern und Panzerglasscheiben, ganz so, als sei es das Selbstverständlichste und Normalste der Welt, sie dergestalt eingesperrt zu halten; und vereinzelt werden auch hierzulande immer noch Schimpansen zu Zirkuszwecken mißbraucht: schuhplattelnd und mit Tirolerhut auf dem Kopf werden sie als Karikaturen ihrer selbst vorgeführt (vgl. hier).
Auch wenn Zoos gerne behaupten, es gebe kaum einen anderen Lernort, an dem man Natur besser beobachten und verstehen lernen könne, als gerade einen Zoo, ist das genaue Gegenteil der Fall: Zoos eignen sich zu nichts weniger, als einen sinnfälligen Bezug zur Natur herzustellen. Gerade deshalb fällt den Besuchern ja auch das Leid der eingesperrten und zur Schau gestellten Tiere nicht auf. Und genau darum geht es: all die Zerrbilder und Klischees, die der Besucher im Zoo vorgeführt bekommt, dienen dazu, eins-zu-eins die alttestamentarisch grundgelegte und über Descartes herabgekommene Doktrin zu bestätigen, dass der Mensch dem Tiere – hier dem Affen – unermesslich überlegen sei und sich seiner insofern nach Belieben bedienen könne, und sei es nur zum persönlichen Gaudium. Nicht umsonst zählt der sonntagnachmittägliche Besuch des örtlichen Zoos mit Kindern und Enkelkindern zum absolut unverzichtbaren pädagogischen Standardprogramm (vgl. hier)
Zu den Ikonen medialer Nachkriegssozialisation zählte der langjährige Direktor des Frankfurter Zoos (und frühere NS-Opportunist), Bernhard Grzimek, der zur Entwicklung rechten Natur- und Tierverständnisses den regelmäßigen Besuch zoologischer Einrichtungen anempfahl. Zu seiner ab 1956 ausgestrahlten Fernsehshow "Ein Platz für Tiere", die es bis in die 1980er hinein auf 175 Folgen und bis heute unerreichte Beliebtheitswerte brachte, nahm er regelmäßig Tiere aus seinem Zoo mit ins Studio, immer wieder auch Menschenaffenbabies.
Hand in Hand mit dem über Zoos vermittelten Bild des Menschenaffen geht jenes, das - mit Ausnahme weniger Dokumentarfilme - in Kino- und TV-Produktionen vorgeführt wird. Filmschimpansen etwa sind immer zu Späßchen aufgelegt, ob nun Cheeta aus den Tarzanfilmen, Judy aus Daktari oder „Unser Charly“ aus der gleichnamigen ZDF-Vorabendserie: stets gut gelaunt, schelmisch, Charly immer mit lustiger Latzhose oder mit Bermuda-Shorts; dazu intelligent, hilfreich, zuverlässig, dem Menschen gegenüber absolut loyal und diesem im Zweifelsfall weit mehr zugeneigt als den eigenen Artgenossen oder sonstigen Tieren.
Nicht zu vergessen Planet der Affen von 1968, neben Star Wars erfolgreichster Science-Fiction-Film aller Zeiten mit fünf Nachfolgefilmen, zwei eigenen TV-Serien, einer Comicheftserie sowie einem Remake von 2001. Worum es geht: Ein Forschungsraumschiff der Erde landet mit Hilfe von Zeitdilatation und bei künstlichem Tiefschlaf der Astronauten 2000 Jahre in der Zukunft auf einem fremden Planeten. Die drei Astronauten treffen bei ihrer Erkundung des Planeten auf steinzeitliche Menschen. Plötzlich tauchen bewaffnete Affen auf, die Treibjagd auf diese Menschen machen und auch die drei Astronauten gefangen nehmen. Es zeigt sich, dass auf dem Planeten – Umkehr der Verhältnisse – die Affen die herrschende Spezies sind: die Menschen werden gejagt, versklavt, nach Belieben auch getötet. Die Affengesellschaft erweist sich als theokratische Diktatur, die zudem in rassische Kasten unterteilt ist: Die Orang-Utans stellen den herrschenden Klerus, Gorillas das Militär, Schimpansen das Bürgertum. Menschen dienen als Arbeitssklaven. Einem der Astronauten gelingt es kraft seiner überlegenen Intelligenz, den Affen zu entfliehen, wobei er sich der Zuneigung einer Schimpansenfrau bedient, die ihm bei der Flucht hilft. Nach seiner Flucht hat er keinerlei Skrupel, mit Waffen aus dem Raumschiff gegen die Affen vorzugehen, auch gegen jene, die ihm zur Flucht verholfen haben. Letztlich stellt sich heraus, dass das Raumschiff auf der Erde der Zukunft gelandet war, auf der nach einem Atomkrieg die Affen die Herrschaft übernommen und die übriggebliebenen Menschen versklavt hatten. Der zunächst durchaus als gesellschaftskritische Parabel daherkommende Plot - die Umkehr der Machtverhältnisse Mensch-Affe - hält diese Linie nicht lange durch. Held ist und bleibt stets der Mensch, der sich erfolgreich gegen die Übermacht der Affen durchsetzt. Diese erscheinen durchwegs als korrupt, faschistoid, bigott und vor allem: als intellektuell äußerst beschränkt, dem menschlichen Helden insofern chancenlos unterlegen. In den nachgeschobenen Folgen des Films treten die sozialkritischen Aspekte, sofern man sie überhaupt als solche bezeichnen kann, komplett in den Hintergrund, da geht es nur noch um Kampf „Affe gegen Mensch“, ein Kampf, den letztlich immer - weil grundsätzlich - der Mensch gewinnt.
Auch das Bild des Gorillas entstammt zunächst dem Zoo, wo man ihn eingesperrt hinter dicken Eisengittern und Panzerglas besichtigen kann. Aus dem Zirkus kennt man ihn weniger, seiner enormen Körperkraft wegen, woraus wir lernen: Gorillas sind gefährlich. Nicht umsonst werden die Leibwächter von Unterweltgrößen seit je als „Gorillas“ bezeichnet, in diametralem Gegensatz zur ausgesprochenen Unaggressivität und Friedfertigkeit wirklicher Gorillas. Man kennt Gorillas auch aus Film und Fernsehen, vorneweg durch King Kong, den Klassiker schlechthin des Monsterfilmgenres, dessen Original von 1933 zu den meistgesehenen und meistkopierten Filmen aller Zeiten zählt. Ein großer schwarzer Affe entblättert eine blonde weiße Frau: die für die abendländische Kultur nachgerade archtetypische Projektionsgeschichte von Rassismus, Sexismus und Speziesismus, alles in einem. Kong, der Inbegriff des Leibhaftigen, von den Eingeborenen seiner Insel in der Südsee als Gott verehrt, wird von einer Expeditionscrew betäubt, gefangengenommen und nach New York gebracht, um dort als „Achtes Weltwunder“ ausgestellt zu werden. Nachdem es ihm gelingt, sich zu befreien und auf das Empire State Building zu klettern, wird er von Flugzeugen aus von diesem Phallussymbol der zivilisierten weißen Männerwelt heruntergeschossen. Wir lernen: selbst der größte und stärkste aller Gorillas ist ein looser, wenngleich ein unterschwellig bedauernswerter, gegen die haushohe Überlegenheit des Homo sapiens.
Das cineastische Rührstück Gorillas im Nebel von 1988, das den Lebensweg der Gorillaforscherin Dian Fosseys nachzeichnet, die 1967 in Ostafrika ermordet wurde, ändert an diesem Bild überhaupt nichts, zumal der Film komplett absäuft in seiner eigenen Sentimentalität und im Pathos für Fossey.
Von Orang Utans wird ein genauso verzerrtes Bild gezeichnet: In Planet der Affen repräsentieren sie die korrupte Priester- und Politikerkaste. Und selbst in dem harmlosen Disney-Trickfilm Das Dschungelbuch ist der Orang Utan auf hinterhältige Weise hinter der Vormachtstellung im Dschungel her: Affenkönig King Louis, der nicht umsonst den Namen des französischen Sonnenkönigs trägt.
Nicht unerwähnt bleiben darf an dieser Stelle der Schimpanse Rotpeter aus Franz Kafkas Bericht an eine Akademie von 1917. Kafka läßt Rotpeter über seine Gefangennahme durch eine Hagenbecksche Tierfangexpedition berichten. Um nicht in den Zoo gesperrt zu werden, so berichtet er, habe er schon auf der Schiffspassage nach Hamburg begonnen, die Menschen zu beobachten. Er habe menschliche Verhaltensweisen und Gesten erlernt, auch die menschliche Sprache und so bald die Durchschnittsbildung eines Europäers erworben. Dennoch, auch nach dem Bericht, den er vor der Akademie über seine Menschwerdung vorträgt, bleibt er für die Öffentlichkeit nichts als ein dressierter Affe. Unabhängig von den üblichen Interpretationen, die Kafkas Stück als Parabel über die letztlich erfolglosen Anpassungsversuche des jüdischen Volkes in Europa deuten: Kafka kannte die Tierfangexpeditionen Hagenbecks, er kannte nachweislich auch einen dressierten Schimpansen namens „Konsul Peter“, der in einem Prager Varieté auftreten musste. Die Interpretation ist zumindest nicht abwegig, dass es in seiner Erzählung ganz konkret auch um Kritik an der kompletten Ignoranz des Bildungsbürgertums der Darwinschen Evolutionstheorie gegenüber ging, die Tierschauen a la Hagenbeck oder Varietés wie das in Prag zuließ.
1. Teil: "Machet sie euch untertan und herrschet..."
Aus einem Vortrag von Colin Goldner auf dem Tierbefreiungskongress 2009 auf Burg Lohra in Thüringen.