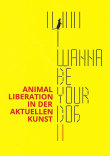Krystyna und Manuel Valverde
Pietá der Tiere
Zu den wohl berühmtesten Kunstwerken nicht nur der italienischen Hochrenaissance, vielmehr des „Weltkulturerbes“ ansich, zählt die vatikanische Pietà des Michelangelo Buonarroti Simoni (1475-1564), bekannt nur unter seinem Vornamen: Michelangelo Schon dessen nachgeborener Zeitgenosse Giorgio Vasari (1511-1574), selbst gefeierter florentiner Künstler und Baumeister, befand in seiner 1550 vorgelegten Biographie des Meisters: „Es wird wohl nie ein anderer Bildhauer den Entwurf dieses Werkes an Anmut und Schönheit übertreffen, noch den Marmor kunstvoller ausmeißeln können.“ Unzweifelhaft sei Michelangelo der „größte Künstler aller Zeiten“.
Das Motiv der Pietà – Maria hält ihren vom Kreuz abgenommenen toten Sohn im Schoß - ist in der abendländischen Ikonographie schon seit Anfang des 14. Jahrhundert bekannt. Zu besonderer Popularität gelangte es im Gefolge der großen Pestepidemien, die Europa zwischen 1346 und 1353 heimsuchten: ein Drittel der damaligen europäi-schen Bevölkerung fiel dem „Schwarzen Tod“ zum Opfer, die Überlebenden suchten Zuflucht bei der Darstellung der um ihren toten Sohn trauernden Gottesmutter. Die Szene stellt die vorletzte Station der Kreuzwegandacht dar und wird volkstümlich als „Vesperbild“ bezeichnet, bezugnehmend auf die Vorstellung, dass Maria den Leichnam Jesu am Karfreitag zur Zeit des Abendgebets, der liturgischen Vesper, entgegennahm. Der Begriff „Pietà“ leitet sich aus der im ausgehenden Mittelalter üblichen lateinischen Bezeichnung für Vesperbild als „Imago Beatae Mariae Virginis de Pietate“ (lat.=„Bildnis der seligen Jungfrau Maria vom Mitleid“) her.
Michelangelo war das Motiv des Vesperbildes also durchaus bekannt. Mit seiner 1499 vollendeten Neufassung einer Pietà - eine Auftragsarbeit für den französischen Kardinal Jean de Villiers de la Grolaye - provozierte der erst 24jährige Michel-angelo einen Skandal ungeheueren Ausmaßes. Bei der Enthüllung der aus strahlend weißem Carrara-Marmor gearbeiteten Skulptur in der Kirche von Santa Petronilla (der Vorläuferin des 1506 begonnen Petersdomes) zeigte sich, dass das Antlitz Mariens nicht das einer alten Frau war - biblischer Überlieferung zufolge müsste Maria zum Zeitpunkt der Hinrichtung Jesu wenigstens fünfzig Jahre alt gewesen sein, was im ausgehenden 15. Jahrhundert als hochbetagt galt -, sondern das eines jungen Mädchens. Die bis dahin auf Vesperbildern übliche Darstellung der Muttergottes war die einer Frau gereifteren Alters. Auf Sandro Botticellis mehrfach gefertigten Tafelbildern „Beweinung Christi“ von 1494/95 etwa wirkt sie fast greisenhaft.
Der öffentlich ausgetragene Streit um Michelangelos Pietà war jedenfalls so vehement, dass Papst Alexander VI (1431-1503) sich genötigt sah, eine theologische Kommission einzusetzen, die sich mit dem als blasphemisch erachteten Bildwerk befasste. Michelangelo entging einem Schuldspruch der Kommission mit sophistischem Verweis auf einen der bedeutendsten Kirchenväter, den Heiligen Irenäus von Lyon (~135-202 u.Z.), dessen bis herauf in die Neuzeit kirchenamtlich anerkannter Lehre zufolge Jungfrauen niemals altern. Wäre nicht, so Michelangelos gewitzte Argumentation, jede Darstellung einer zum Zeitpunkt des Todes Jesu gealterten Maria frevelhafte Gotteslästerung, unterstellte sie doch der Gottesmutter, bei dessen Empfängnis und Geburt nicht jungfräulich geblieben zu sein. Die Pietà war offiziell rehabilitiert und verblieb in Santa Petronilla (von wo aus sie später in den Petersdom überführt wurde).
Michelangelos Frevel
Was also hat Michelangelo dazu bewogen, Maria im Moment ihres größten Schmerzes und entgegen aller ikonographischen Gepflogenheit nicht als „Mater dolorosa“ (lat.= Schmerzensmutter) darzustellen, das heißt: ohne erkennbaren Ausdruck des unermesslichen Leids, das sie, ihr totes Kind im Schoße haltend, zu erdulden hat? Und überdies in makellos-jugendlicher Blüte? Oder anders gefragt: was genau wurde als so skandalös bzw. blasphemisch empfunden, dass sogar Forderungen laut wurden, aus dem Klerus wie aus dem einfachen Kirchenvolk, die Skulptur zu zerstören? Die Darstellung einer jugendlichen Muttergottes an sich konnte es nicht gewesen sein, die den Aufruhr hervorrief: solche Darstellungen Mariens mit Jesuskind auf dem Arm waren spätestens seit dem ausgehenden 14. Jahrhundert weithin geläufig.
Michelangelos Pietà steht in der Tradition religiöser Andachts-bilder, wie sie seit der Hochgotik des frühen 13. Jahrhunderts bekannt waren. Die Motive waren zumeist der Passion Christi entnommen (sogenannte „Schmerzensmann-“ oder „Erbärmde-bilder“). Zu Beginn des 14. Jahrhunderts kam die Darstellung der trauernden Muttergottes hinzu. Michelangelos Bearbeitung des Motivs fällt durch die jugendlich dargestellte Maria aus dem Rahmen all dessen, was die christliche Ikonographie bis dahin vorgab.
Andachtsbildnisse sollten (und sollen) auf Leiden aufmerksam machen, eine innere, mitfühlende Beziehung herstellen zwischen dem Betrachter und dem dargestellten Leid. Tatsächlich tun sie das, wenn überhaupt, nur sehr oberflächlich. Michelangelos Pietà hingegen zieht den Betrachter unwillkürlich in Bann gerade durch den Entzug des reaktiven Affekts: der Betrachter kann sich nicht mehr wie in herkömmlichen Andachtsbildern auf die versteinerten Gesichtszüge einer Mater dolorosa kaprizieren, womit allemal ein selbstschützender Rest innerer Distanz gewahrt bliebe, oder auf den geschundenen Leib Jesu (dessen Wundmale Michelangelo nur andeutet); vielmehr wird er auf das unmittelbare Erleben des Ungeheuerlichen zurückgeworfen, das sich, in Stein gemeisselt, vor seinen Augen abspielt. Und ebendieses Erleben unmittelbaren menschlichen Leids trifft den Betrachter, um einen pentekostalen Begriff zu bemühen, „wie ein Blitz mitten ins Sein“: als Aufruf, hinzugehen, das Leid dieser Welt zu mindern.
Zugleich läßt es schlagartig die Absurdität, ja den Irrwitz der christlichen Heilslehre ins Gewahrsein treten: der Versöhnung eines rach- und strafwütigen Gottes mit dem Menschen durch Schmerzen, Leiden und Tod. Gerade die Gestalt der jungen, aufblühenden Maria, der ohne jede Schuld das größte Leid aufgebürdet wird, das einem Menschen widerfahren kann - der Tod eines Kindes -, läßt die Wahnhaftigkeit des christlichen Schuld- und Sühnekonstruktes zumindest erahnen. Ebendieser Ahnung wegen, so möchte man annehmen, wurde Michelangelos Meisterwerk von seinen Zeitgenossen der Blasphemie geziehen. Dass es bis heute als eines der „größten Kunstwerke aller Zeiten“ verehrt wird, auch und gerade von gläubigen Christen, ist nur vermeintlich ein Wunder: derlei Verehrung unterbindet kognitive Dissonanz.
ps: Am Pfingstsonntag des Jahres 1972, an dem im Petersdom, wie üblich und mit liturgischem Pomp, die Herabkunft des „Heiligen Geistes“ zelebriert wurde, ertrug ein Besucher des päpstlichen Pontifikalamtes besagte Dissonanz nicht länger: er schlug mit einem Hammer und wie von Sinnen auf Michelangelos Pietà ein, wobei er lauthals verkündete, der auferstandene Christus zu sein. Der 33jährige Amokläufer brach einen Arm der Marienfigur ab, zudem beschädigte er ihre Nase und ein Auge schwer. Man brachte ihn in die Psychiatrie, Papst Paul VI weigerte sich, mit ihm zu sprechen. Die Figur wurde stillschweigend restauriert.
Ohne falsche Pietät…
Im Jahre 2015 trat die junge polnische Künstlerin Krystyna Jankowska ihrerseits mit einer Pietà an die Öffentlichkeit. Rein formal handelte es sich dabei um die Abschluß-arbeit ihres Diplomstudiums im Fach „Bildhauerei“ an der renommierten Hochschule für Gestaltung in Offenbach am Main. Die als „Pietà der Tiere“ bezeichnete lebens-große Skulptur, in der eine Schimpansenmutter, auf einer Öltonne sitzend, ein totes Delfinkind im Schoße hält, lehnt sich bewusst und ausdrücklich an die vatikanische Pietà Michelangelos an und führt sie fort über die Speziesgrenze des Menschen hinaus. Die Künstlerin selbst (die die Skulptur mit Hilfe ihres Künstlerkollegen und Lebens-gefährten Manuel Valverde geschaffen hat) sagt dazu, sie wolle in der Tradition religiöser Andachts- oder Vesperbilder, deren berühmtestes eben Michelangelos Pietà ist, für das Leid der Tiere sensibilisieren und zur Reflexion anregen über unseren Planeten und die Umwelt.
Ganz wie bei Michelangelos Muttergottes ist auch das Gesicht der Schimpansenmutter nicht vom Schmerz über den Verlust ihres (Delphin-)Kindes gezeichnet; auch dieses selbst ist, gleich dem toten Jesus, ohne äußere Zeichen der Gewalt, die ihm angetan wurde. Und auch in der „Pietà der Tiere“ wird der Betrachter auf das unmittelbare Erleben der Tragödie zurückgeworfen, die sich vor ihm auftut.
Krystynas Werk ist ästhetisch wie handwerklich von ähnlicher Perfektion wie das Michelangelos. Beide Skulpturen atmen denselben Geist, beide verstehen sich und sind zu verstehen als unüberhörbares Fanal, dem Leid dieser Welt ein Ende zu bereiten. Im Grunde könnten Muttergottes und Schimpansenmutter ihre Plätze tauschen, ebenso wie Delphin und Jesus (zumal sie in ihrer Leidensfähigkeit einander in nichts nachstehen). In ihrer katholisch-polnischen Heimat, in der die vatikanische Pietà jedermann geläufig ist, bekäme Krystyna wohl große Probleme, wollte sie ihr Werk dort zeigen: es würde ihr als Blasphemie ausgelegt werden. Krystyna selbst, gleichwohl in einem streng Papst-Wojtyła-gläubigen Polen aufgewachsen, hat sich längst von Religion befreit und konnte sich gerade deshalb ohne falsche Pietät des Pietá-Motiv bedienen.
Wie die vatikanische Pietà den Irrwitz der christlichen Heilslehre ins Bewusstsein des Betrachters trägt, durch Leid Erlösung von Schuld zu erlangen (die es ohne diese Heilslehre gar nicht gäbe), wirft die „Pietà der Tiere“ ein Schlaglicht auf das Komplettversagen dieser Heilslehre mit Blick auf das Tier bzw. die von ihr so apostrophierte „Wahrung der Schöpfung“.
Tierrecht und Religionskritik
Der Dominikanermönch Thomas von Aquin [1225-1274] gilt bis heute als mit Abstand einflussreichster aller Kirchenlehrer; in Sonderheit mit Blick auf seine Lehre des „essentiellen“ Unterschiedes zwischen Mensch und Tier. Mit ihm wurde die in der Bibel grundgelegte Doktrin der Gottebenbildlichkeit des Menschen, die diesen über die gesamte Natur erhebe und diese seiner Herrschaft und Nutzung unterwerfe, mit Nachdruck festgeschrieben. Das biblische Diktum aus dem 1. Buch Moses, in dem Gott selbst seinen Ebenbildern befiehlt, sich die Erde untertan zu machen und zu herrschen „über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht.“ [1.Mose 1,28], wurde zur zentralen Maßgabe des Umganges mit dem Tier.
Und es gilt dieses Verdikt unverändert bis heute und besetzt das kollektive Bewusst-sein wie kein zweites: In einem „Hirtenschreiben“(!) von 1980 beispielsweise teilt die Deutsche Bischofskonferenz mit, Tiere hätten, im Unterschied zum Menschen, „kein unantastbares individuelles Lebensrecht“. Folglich seien „wir Menschen berechtigt, Leistungen und Leben der Tiere in Anspruch zu nehmen“. Unmissverständlicher noch erklärt der aktuell gültige Weltkatechismus der Katholischen Kirche, federführend herausgegeben im Jahre 1993 durch den seinerzeitigen Kurienkardinal und heutigen Ex-Papst Joseph Ratzinger: „Gott hat die Tiere unter die Herrschaft des Menschen gestellt, den er nach seinem Bilde geschaffen hat. Somit darf man sich der Tiere zur Ernährung und zur Herstellung von Kleidern bedienen. Man darf sie zähmen, um sie dem Menschen bei der Arbeit und in der Freizeit dienstbar zu machen.“ Auch medizinische und wissenschaftliche Tierversuche seien „sittlich zulässig“. Und weiter heißt es im katholischen Weltkatechismus: „Es widerspricht der Würde des Menschen, Tiere nutzlos leiden zu lassen und zu töten“, was im Umkehrschluß nichts anderes bedeutet als: ist ihr Leiden und Tod dem Menschen zunutze, ist beides gerechtfertigt.
Sorgt Gott für die Ochsen?
Es gibt bezeichnenderweise in der gesamten Bibel keinen einzigen Satz, in dem Tieren Schutz vor der Rohheit und Gier des Menschen zugesprochen würde. All die mühsamen Versuche „moderner“ oder „zeitgeistiger“ Exegeten, irgendwelche tierfreundlichen Passagen in die Bibel hinein- oder aus dieser herauszuinterpretieren, sind leeres Gerede. Allen Ernstes deuten diese Exegeten, vornedran der derzeitige Papst Bergoglio, das Herrschafts- und Unterjochungsgebot aus dem 1. Buch Moses in einen Auftrag Gottes an den Menschen um zu „verantwortungsvollem Leiten“ der ihm an die Hand gegebenen Mitgeschöpfe: „Heute wissen wir“, wie der aktuell oberste Hüter des Weltkatechismus, der Wiener Kardinal Christoph Schönborn, zu sekundieren weiß, „dass der sogenannte Herrschaftsauftrag der Bibel an den Menschen nichts anderes meint als liebende Sorge für die ihm anvertraute Schöpfung und hegendes Bewahren.“
Tatsächlich drehen sich die von Schönborn und anderen zusammengesuchten Text-passagen, in denen Tieren, auf den ersten Blick zumindest, ein gewisser Schutz zugebilligt wird, ausschließlich um den Erhalt ihres Nutz- und Vermögenswertes. „Nutztiere“, und nur um die geht es, sollen so mit Nahrung und Wasser versorgt werden, dass ihre Arbeitskraft best- und längstmöglich verfügbar bleibt. Die als schlagender Beleg für die besondere Tierfreundlichkeit des Alten Testaments angeführte Anweisung Gottes: „Du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden“ [5.Mose, 25,4] wird von Paulus im 1. Korintherbrief jeder Missverständ-lichkeit enthoben: „Sorgt Gott für die Ochsen? Oder sagt er's nicht allerdinge um unsertwillen? Denn es ist ja um unsertwillen geschrieben.“ [1.Kor 9, 10-11].
Die alttestamentarischen Vorgaben zum Verhältnis Mensch-Tier setzen sich nahtlos fort in jenen des Neuen Testaments. „Für die christliche Sicht bleibt grundlegend“, so die Amtskirchen in wortgleichem Grundsatz, „wie die Bibel dieses Verhältnis bestimmt“ hat. Der vielzitierte „Gute Hirte“ des Neuen Testaments, der sich um jedes seiner Schafe besorgt, tut dies keineswegs um der Tiere willen, vielmehr, um mit Karlheinz Deschner zu sprechen, hegt er seine Herde erstens, damit er sie scheren und zweitens, damit er sie fressen kann.
„Gelobt seist du…“
Die Bezugnahme der katholischen Kirche auf sogenannte „Tierheilige“ wie Ägidius, Walburga oder Wendelin ist, ebenso wie die stete Inszenierung von Tiermessen, Tiersegnungen und dergleichen, nichts denn zynische Farce. Nirgendwo geht es um Segnung, sprich: Schutz der Tiere um ihrer selbst willen, allenfalls sollen sie durch den Segen vor Krankheit und Unfall bewahrt werden, um umso besser ausgebeutet werden zu können. Auf eigenen Hubertusmessen werden die Jäger gesegnet, vor Walfang-fahrten die Walschlächter, vor Stierkämpfen die Toreros. Keine Eröffnung eines Zoos oder Delphinariums, keine Zirkuspremiere, keine noch so abartige Tierquälerei im Gewande von Tradition oder Brauchtum – Entenwerfen, Gänsereiten, Widderstoßen und ähnliche Spektakel -, ohne dass nicht ein Priester seinen Weihwasserwedel schwänge.
Der seit März 2013 als Franziskus I amtierende Papst Bergoglio bezieht sich in seiner Namenswahl ausdrücklich auf den „Tierschutzheiligen“ Franz von Assisi (der erst 1980 per Dekret Johannes Paul II zu solchem ernannt worden war), den er als Beispiel schlechthin lobt „für eine froh und authentisch gelebte ganzheitliche Ökologie“. Im Juni 2015 legte er ein eigenes Öko-Rundschreiben vor, in dem er sich schwerpunktmäßig mit den Themenbereichen Umwelt- und Klimaschutz befasst. Der Titel der Enzyclica Laudato si ist der Anfang eines dem Heiligen Franz von Assisi zugeschriebenen Gebetes („Gelobt seist du, mein Herr, mit all deinen Geschöpfen“). Wie zu erwarten, änderte die neue Rhetorik an der katechetischen Doktrin der katholischen Kirche zum Umgang mit der Natur überhaupt nichts; zum Umgang mit Tieren, die in Laudato si nicht einmal erwähnt werden, erst recht nichts.
Nicht nur die katholische Kirche, auch die evangelische, die anglikanische, die russisch-orthodoxe usw., sprich: sämtliche christlichen Religionsgemeinschaften, desgleichen das Judentum und der Islam in all ihren Ausprägungen, beziehen sich grundlegend auf die biblisch begründete Einzigartigkeit des Menschen als Ebenbild Gottes samt dem daraus hergeleiteten Anspruch des Menschen, die Natur zu beherrschen.
Es ist das Wesen jeder Religion, den Menschen aus der Natur herauszuheben und ihn - dies die ursprüngliche Bedeutung des Begriffes re-ligio -: rückanzubinden an Gott bzw. je nach theologischer Ausrichtung an mehrere und unterschiedliche Götter, an das Göttliche, das Numinose usw. Religion, zumindest in ihren dogmatisch verfassten Formen, ist immer Ausdruck und Rechtfertigung der Herrschaft von Menschen über Menschen und vor allem: Herrschaft des Menschen über die Natur und insbesondere: das Tier.
Ein herrschafts- und ausbeutungsfreier Blick auf das Tier muß insofern immer und grundlegend mit einer Befreiung von Religion einhergehen. Die „Pietà der Tiere“ weist den Betrachter eindringlich - als nachgerade „pfingstliches Erleuchtungserlebnis“ - darauf hin.
Colin Goldner
Aus dem Begleitbuch der Ausstellung "I Wanna Be Your Dog#2: Animal Liberation in der Aktuellen Kunst" im Künstlerhaus Dortmund (5.5.-1.7.2018). ISBN 978-3-00-058435-0