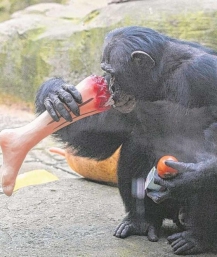Wissenschaft und Forschung
Wissenschaft und Forschung im Zoo?
Viele Zoos beschreiben sich ausdrücklich als wissenschaftsorientierte Forschungseinrich-tungen. Für Zoos, die den Dachverbänden WAZA und EAZA bzw. dem Verband der Zoologischen Gärten e.V. (VdZ) ange-schlossen sind (bzw. angeschlossen werden wollen), gilt „Wissenschaftlichkeit“ gar als konstitutives Element.
Was es mit diesem Anspruch auf sich hat, mit dem Zoos mithin ihre Existenz rechtfertigen, sei exemplarisch anhand des Zoos Bremerhaven untersucht. Laut Selbstdarstellung pflegt der Zoo eine „Zusammenarbeit mit Hochschulen, Universitäten und wissenschaftlichen Instituten“, biete er doch nachgerade ideale Bedingungen für Wissenschaft und Forschung. Bei näherer Hinsicht stellt sich freilich heraus: weder aus dem Bremerhavener noch aus einem der sonstigen Zoos heraus gibt es nennenswerte wissenschaftliche Forschungsergebnisse, ganz abgesehen davon, dass die Zoos in aller Regel gar nicht selbst forschen, sondern studentische Projekt-, Haus- oder Abschlussarbeiten, für die sie allenfalls das Studienobjekt abgeben, als Ausweis eigener Forschertätigkeit reklamieren.
Die „wichtigen Erkenntnisse zum Wohl der Tiere im Zoo und in freier Wildbahn“, die der Bremerhavener Zoo gewonnen haben will, sind sehr überschaubar: seit seiner Neueröffnung im Jahre 2004 listet er exakt fünf wissenschaftliche Publikationen zu zoobiologischen bzw. zooveterinären Fragestellungen auf. Das Entscheidende an diesen Arbeiten aber ist, dass sie weder von MitarbeiterInnen des Zoos durchgeführt noch von diesen veröffentlicht wurden - der Zoo stellte lediglich Tiere für Untersuchungen externer Wissenschaftler zur Verfügung -, gleichwohl aber als hauseigene Forschungsbeiträge ausgewiesen werden; das gleiche gilt für zwei Posterpräsentationen, sowie verschiedene Projekte des Leipziger Max Planck-Instituts bzw. des Europäischen Erhaltungszuchtprogrammes (EEP), an denen der Bremerhavener Zoo in nicht näher beschriebener Weise beteiligt gewesen sein will. Die zwei einzigen von Zoodirektorin Heike Kück selbst vorgelegten Arbeiten (zum einen über die Eisbärenzucht im Bremerhavener Zoo und zum anderen über das hauseigene „Nordseeaquarium“) wurden in Publikumszeitschriften ohne wissenschaftlichen Anspruch (bzw. dem Newsletter des Weltzooverbandes WAZA) veröffentlicht; auch ein 2014 von Kück veröffentlichtes Buch zur „Erfolgsgeschichte der Bremerhavener Eisbärenzucht“ kann nur schwerlich als Beitrag zur Wissenschaft gewertet werden.
Von den fünf studentischen Projektarbeiten, die in Kooperation mit dem Zoo durchgeführt wurden, befassten sich zwei mit Fragen des Zoomanagements, die drei anderen waren simple Tierbeobachtungen. Ein ähnliches Bild sowohl bei den fünf vorgelegten Haus- bzw. Semesterarbeiten als auch bei den acht Examens-, Bachelor- und Masterarbeiten, die der Zoo für sich reklamiert: nur eine einzige Arbeit wies in ihrer Themenstellung über reine Zoobelange hinaus.
Ungeachtet der Frage, ob studentische Projekt-, Haus- oder Semesterarbeiten als wissenschaftliche Arbeiten angesehen werden können - selbst bei Bachelor- und Masterarbeiten ist dies fraglich -, ist der vom „Zoo am Meer“ geleistete Beitrag zu Wissenschaft und Forschung nicht eben beeindruckend. Zieht man die Arbeiten ab, die sich selbstreferentiell um zooeigene Fragestellungen drehen, bleibt selbst bei den Abschlußarbeiten kaum etwas übrig. Am wenigsten können derlei bescheidene wissenschaftliche Beiträge als Rechtfertigung für die fortdauernde Gefangenhaltung von Wildtieren gelten. Zur Untermauerung seiner „Wissenschaftlichkeit“ führt der Bremerhavener Zoo überdies an, „bereits als idealer Austragungsort wissenschaftlicher Tagungen“ gedient zu haben. Tatsächlich gab es in den dreizehn Jahren seit seiner Neueröffnung eine einzige [!] Tagung, die vielleicht als solche gelten kann: nämlich das reihum in je einem anderen Zoo veranstaltete Jahrestreffen von Zootierärzten. Darüberhinaus hat der hauseigene Veterinär drei kleinere Beiträge zu solchen Jahrestreffen in anderen Zoos vorgelegt. Nicht zu vergessen: es fanden fünf je 2-tägige Seminarveranstaltungen für StudentInnen der veterinärmedizinischen Hochschule Hannover im Zoo statt, die allerdings nur schwer als „wissenschaftliche Tagungen“ gelten können. Ansonsten gab es in den zurückliegenden dreizehn Jahren schlichtweg nichts, was die Behauptung stützen könnte, der Bremerhavener Zoo sei „idealer Austragungsort wissenschaftlicher Tagungen“ oder habe sonst irgendetwas mit wissenschaftlicher Forschung oder Lehre zu tun.
Die nachgerade zwanghafte Fixation auf das Etikett der „Wissenschaftlichkeit“ - selbst Zoos, die noch nie irgendeine wissenschaftliche Erhebung durchgeführt, geschweige denn: ein wissenschaftliches Papier veröffentlicht haben, beharren darauf, „wissenschaftlich“ geleitet zu sein - hat zwei simple Gründe: zum einen verschafft die Behauptung, wissenschaftliche Forschung zu betreiben, den Zoos eine Art Metalegitimierung, die sie gegen Kritik immunisiert, reine Vergnügungsparks auf Kosten eingesperrter Tiere zu sein, und zum anderen bedeutet der Betrieb eines Zoos unter dem Signet der „Wissenschaftlichkeit“ die einzige Möglichkeit, Tiere bedrohter Arten aus dem Ausland zu beziehen (bzw. ins Ausland abzugeben): Tiere, die den Regularien des Washingtoner Artenschutzübereinkommens (CITES) von 1973 unterliegen - es gelten diese Regularien sowohl für Wildfänge als auch für Gefangenschaftszuchten -, dürfen über Ländergrenzen hinweg nur gehandelt, gemakelt oder von Zoos untereinander ausgetauscht werden, wenn behördliche Aus- und Einfuhrgenehmigungen vorliegen und „kein kommerzielles Interesse“ damit verfolgt wird. Nur wenn der Handel „wissenschaftlichen Forschungszwecken“ dient, können entsprechende Genehmigungen erteilt werden. „Wissenschaftlich geleitete“ Zoos erhalten die erforderlichen CITES-Papiere regelmäßig und für jedes auf dem Markt verfügliche (bzw. zu veräußernde) Tier.
Colin Goldner
TIERBEFREIUNG #95, Juni 2017