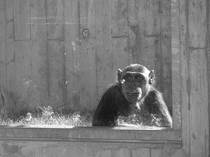Zoo Heidelberg
"Leben Live Erleben"
Der Zoo Heidelberg
Der Heidelberger Tiergarten wurde im Jahre 1933 begründet und im Jahr darauf feierlich eröffnet. Das Anfangskapital speiste sich aus einer Stiftung, die der ortsansässige Chemiker und Nobelpreisträger Carl Bosch ins Leben gerufen hatte.
In den Anfangsjahren wurden in dem als „Kurpfälzischer Tiergarten mit Vogelwarte“ bezeichneten Zoo in erster Linie heimische Vögel sowie heimisches „Nieder- und Rotwild“ gezeigt, dazu ein Kamel und ein paar Makaken. Wenige Wochen vor Kriegsende wurden die Gehege- und Parkanlagen bei einem Bombenangriff fast völlig zerstört.
Der Wiederaufbau ging relativ schleppend voran, erst ab Anfang der 1960er wurde wieder in nennenswertem Umfang in den Zoo investiert. Heute hält der Heidelberger Tiergarten auf einer Fläche von etwa 10 Hektar 1300 Tiere aus 170 Arten vor. Der Zoo wird in der Rechtsform einer gGmbH betriebenen, Hauptgesellschafterin ist mit 99 Prozent der Anteile die Stadt Heidelberg.
Besonderes Augenmerk richtet der Zoo auf die „Tierbeschäftigung“: So werde der Alltag der Tiere, wie es auf der website des Zoos heißt, „durch eine Vielzahl an Beschäftigungsmöglichkeiten abwechslungsreich gestaltet. Für die Schimpansen etwa halten die Pfleger ein besonderes Programm bereit. In der sogenannten Futterbox, einer etwa koffergroßen Kiste, werden wohlschmeckende Leckereien versteckt. Diese können nur in mühsamer Kleinarbeit mit kleinen Stöckchen herausgeangelt werden. Unseren Löwen wird das Futter manchmal erhöht aufgehängt, so dass es nur mit einem mächtigen Sprung erreicht werden kann.“ Auch die zu den „Hauptattraktionen“ des Zoos zählenden Showfütterungen der Mähnenrobben, bei denen die Tiere zirzensisch andressierte Kunsttücke vorführen müssen, firmieren als Teil des „Beschäftigungs-programms“. Eigenem Bekunden zufolge zählt der Heidelberger zu den „führenden Zoos im Bereich der Tierbeschäftigung“.
Unter dem Stichwort „Bildung hautnah“ wird über eine hauseigene Zooschule zoopädagogischer Unterricht für Kindergarten- und Schulgruppen angeboten; dazu gibt es einen eigenen „Dschungellehrpfad“, einen „Kletterwald“, sowie, verteilt über das ganze Gelände, verschiedene Spielplätze mit Rutschbahnen, Trampolinen, Schaukeln etc.; selbstredend auch einen „Streichelzoo“. Über die Zooschule werden auch Kindergeburtstage ausgerichtet, desgleichen Sonderveranstaltungen wie „Karneval im Zoo“, „Zoocamps“ (mit Übernachtung im Zoo) „Fährtensafaris“, „Kinderschminken“ oder „Waffelbacken“. Vermeintlich besonders originell: „Der Osteraffe kommt!“ oder „Zoo-Halloween“ mit „Gruselstationen für die ganze Familie“.
Ausdrücklich versteht der Heidelberger Zoo sich als „Kulturinstitution“, deren Ziele und Methoden sich nur graduell von allgemein anerkannten Kulturinstituten wie Museen unterschieden. Wiederkehrend werden insofern in den Tierhäusern Ausstellungen verschiedener Künstler gezeigt, rund um das Menschenaffenhaus sind Skulpturen afrikanischer Bildhauer zu sehen. Laut Zoodirektor Klaus Wünnemann sei der Zoo einer der besten Orte überhaupt, um Kunst zu präsentieren, die dergestalt an die „bildungsferneren Schichten“ [!] herangetragen werde, die eben lieber Zoos besuchten als Museen.
Dreiste Lügen
Seit Mitte der 1970er werden im Heidelberger Zoo Menschenaffen vorgehalten. Bilder aus dieser Zeit zeigen indiskutable Haltungsbedingungen, wie sie vereinzelt auch heute noch anzutreffen sind: die ehemalige „Bärengrube“ etwa, ein vor dem Krieg schon gebautes Betonverlies, ist bis heute mit Stachelschweinen und Waschbären besetzt [letztere wurden inzwischen ausgelagert]. Erst Mitte der 1980er wurde ein eigenes „Menschenaffenhaus“ gebaut, das 1988 seiner Bestimmung übergeben wurde. Das Haus besteht, ganz im Stil der Zeit, aus einem achteckigen Sichtbetonbau mit Glasdachkonstruktion. Dem Bau direkt angeschlossen finden sich mehrere Freigehege. Der atriumsartig gestaltete Innenraum weist in der Mitte eine Pflanzinsel mit „Urwaldbewuchs“ auf, um die herum der Besucherweg an vier umlaufend angelegten Innengehegen vorbeiführt; diese sind mit je einer Gruppe Orang Utans, Schimpansen, Gorillas und Roloway-Meerkatzen besetzt. Zur Erzeugung von „Regenwaldatmosphäre“ sind zudem in unterschiedlich großen Käfigen Seiden- und Löwenäffchen, Spitzhörnchen, Goldagutis und Emeraldstauben untergebracht.
Die Gehege der Schimpansen und Gorillas wurden in jüngerer Zeit umgestaltet, die bis dahin bestehenden Betongräben zum Besucherbereich hin wurden aufgefüllt. Im Gehege der Orang Utans hingegen hat sich nichts geändert: der ursprüngliche Graben – bis zum Einbau umlaufender Panzerglas-scheiben waren die Gehege nach vorne hin offen – wurde hier beibehalten. Die derzeit drei vorgehaltenen Tiere sitzen auf etwa 60qm nacktem Betonboden. Auch die Wände und die Rückseite des Geheges bestehen aus nacktem Beton; nach oben hin ist es mit einer massiven Stahlgitterkonstruktion gesichert. An Einrichtung weist es Totholzstämme, künstliche Felsen, ein paar Seile und Feuerwehr-schläuche sowie eine aufgehängte Plastiktonne auf. Versteck- oder Rückzugsmöglich-keiten für die Tiere gibt es nicht.
Die benachbarten Schimpansen- und Gorillagehege, in denen derzeit je fünf Tiere vorgehalten werden, weisen, bedingt durch die Auffüllung der Betongräben, von ursprünglich 60 auf nunmehr 100qm vergrößerte Innenflächen auf. Die Seiten- und Rückwände bestehen wie bei den Orang Utans aus nacktem Beton, einen Blick ins Freie gibt es nicht. Auch die Einrichtung entspricht der des Orang Utan-Geheges, anders hingegen als in diesem sind die Böden mit Rindenmulch bzw. Torf bedeckt. Nach oben hin sind die Gehege mit Drahtnetzen überspannt, Versteck- oder Rückzugsmöglichkeiten gibt es auch für die Gorillas und Schimpansen nicht.
Gerade der Vollbetonbunker, in dem die Großen Menschenaffen untergebracht sind, lässt das vielzitierte Motto des Heidelberger Zoos „Leben live erleben“ noch abstruser erscheinen, als es ohnehin schon ist. Als schierer Zynismus sind die vorgeblich nach „didaktischen Gesichtspunkten“ aufbereiteten Informationen zu werten, die die Besucher im hauseigenen „Zooführer“ geboten bekommen: Orang Utans, Gorillas und Schimpansen seien aufgrund ihres hochentwickelten Gehirns „zu einem besonders vielgestaltigen und komplexen Sozialleben, zu beindruckenden Gedächtnis- und Kombinationsleistungen und zu einem nachweisbaren Ich-Bewusstsein befähigt“. Weshalb sie gleichwohl, eingesperrt hinter zentimeterdickem Panzerglas, einem gaffenden Publikum zur Schau gestellt werden, beantwortet der Zooführer nicht. Mit der Behauptung im Übrigen, nachzulesen auf einer Infotafel im „Menschenaffenhaus“, in Zoos gehaltene Gorillas „stammen heutzutage nicht mehr aus der freien Natur, sondern wurden bereits im Zoo geboren“, wird das Publikum dreist belogen. Tatsächlich sind weit über hundert der etwa 850 rund um den Globus in Zoos einsitzenden Gorillas sogenannte „Wildfänge“, die als Kleinkinder in Zoos verschleppt wurden. Auch in deutschen Zoos sitzen noch „wildgefangene“ Gorillas, beispielsweise in Berlin (Fatou*1957), Krefeld (Massa*1971) oder München (Roututu*1973 [Nov 2014 verstorben]); in Nürnberg stammen gar drei der fünf vorgehaltenen Gorillas aus „Wildfängen“ (Fritz*1963, Bianka*1972, Lena*1977), was die Kuratorin des Heidelberger Zoos, Sandra Reichler, die als Committee-Mitglied der Europäischen Erhaltungszuchtprogramme (EEP) zuständig ist für die „Nachzucht“ mithin von Gorillas, sehr genau wissen dürfte.
Das „Beschäftigungsangebot“ des Heidelberger Zoos für die Großen Menschenaffen unterscheidet sich in nichts von dem, was in den meisten Zoos mittlerweile als - völlig unzureichender - Standard gilt: nämlich das Essen irgendwo im Gehege zu verteilen oder zu verstecken, so dass die Tiere für einige Zeit damit zu tun haben, es sich zusammenzusuchen oder aus irgendwelchen Behältern herauszupulen. Darüberhinaus gibt es ersichtlich keinerlei cognitive enrichment, die meiste Zeit des Tages sitzen die Tiere ohne den geringsten Beschäftigungsanreiz und insofern zu Tode gelangweilt herum. Die Behauptung, die Besucher selbst trügen „zu einem Großteil der täglichen Unterhaltung“ der Affen bei, da „viele der mitgebrachten Gegenstände - ein Eis, ein Sonnenschirm am Kinderwagen oder eine große Tasche - immer wieder die Aufmerksamkeit der intelligenten Tiere“ auf sich zögen, ist an Zynismus kaum zu überbieten: Keine Rede von dem ständigen Hin-und-her zwischen der tödlichen Langeweile einerseits, die den immergleichen Alltagsablauf bestimmt und den Tieren keine Möglichkeit lässt, arteigenen Bedürfnissen nachzugehen, und der Anspannung andererseits, die die Menschenmassen bedeuten, die, unstet und lärmend, sich Tag für Tag an ihnen vorüberwälzen, ohne dass sie eine Chance hätten, sich zurückziehen oder zu entfliehen.
Die Außenanlage der Orang Utans besteht aus einem simplen Drahtgitterkäfig, der mit ein paar Seilen und Feuerwehrschläuchen ausgestattet ist. Das von fünf Meter hohen Betonwänden umgebene Außengehege der Gorillas ist zur Besucherseite hin offen, sprich: von dieser durch einen drei Meter tiefen - und für die Tiere extrem verletzungs-trächtigen - Betongraben abgetrennt. Im Freigehege der Schimpansen wurde der Betongraben im Jahre 2011 aufgefüllt, so dass sich die zur Verfügung stehende Grundfläche um 60 Prozent auf knapp 250qm vergrößerte; zur Besucherseite hin wurde die Betonmauer geschlossen und mit großformatigen Sichtfenstern versehen; das Gehege ist von einem über Stützpylonen zeltartig nach oben gezogenen Stahlnetz überspannt und mit ein paar Totholzkletterbäumen bestückt. Sämtliche Außenanlagen weisen Naturboden auf, Sichtblenden oder sonstige Rückzugsmöglichkeiten für die Tiere gibt es nicht.
Nicht unerwähnt bleiben soll an dieser Stelle der mysteriöse Tod zweier Gorillas im Juni 2013. Erst verstarb unerwartet das 14 Monate alte Gorilla-Baby KIU: das
Ergebnis der Obduktion, obwohl groß angekündigt, wurde nie veröffentlicht. Kurze Zeit später entschied der Zoo, die 17jährige Gorilla-Dame DOBA, deren Gesundheitszustand sich seit einiger Zeit rapide
verschlechtert hatte, zu ihrem eigenen Wohl „einzuschläfern“. Was genau die Ursache ihres Abbaus war, teilte der Zoo nicht mit, stressbedingtes oder psychisches Leiden jedoch, so eine offizielle
Verlautbarung, könne „definitiv ausgeschlossen“ werden. [Im Originaltext war versehentlich von Orang Utans die Rede, tatsächlich handelte es sich um Gorillas.]
Pseudoartenschutz
2010 beteiligte sich der Zoo Heidelberg an der sogenannten „Menschenaffenkampagne“ des Europäischen Zooverbandes (EAZA) zum Schutz der Menschenaffen in ihren natürlichen Lebensräumen Über das Aufstellen einiger Informationstafeln hinaus beschränkte sich das Heidelberger Engagement in erster Linie auf das Sammeln von Spendengeldern. Laut Pressemeldung des Zoos konnten in der zwölf Monate dauernden Kampagne exakt 3866,41 Euro an Spenden eingenommen und weitergereicht werden: „Der gesamte Erlös fließt in Maßnahmen, die in verschiedenen afrikanischen Ländern sowie in Indonesien zur Bewahrung des natürlichen Lebensraumes und der Eindämmung der Jagd auf Menschenaffen beitragen.“ Für sein nachgerade lachhaftes Engagement zum Schutz der Menschenaffen - das Spendenaufkommen lag bei umgerechnet 0,64 Cent pro Besucher - wurde der Heidelberger Zoo von der EAZA mit einem „Bronze-Award“ ausgezeichnet. Die Urkunde wird stolz auf der Website des Zoos präsentiert.
Für die 2012/13 aufgelegte und ebenfalls über 12 Monate laufende EAZA-Kampagne zum „Erhalt bedrohter Tierarten in Südostasien“ (Elefanten, Tiger, Languren, Hornvögel, Pythons u.v.a.) trug der Zoo Heidelberg mit seinen angeblich 600.000 Besuchern pro Jahr gerade einmal 1814,66 Euro bei.
Schmetterlingsammler und NS-Wehrwirtschaftsführer
Mit Stolz verweist der Heidelberger Zoo auf seinen „Gründervater und Mäzen“, Geheimrat Carl Bosch (1874-1940), der im Jahre 1931 den Nobelpreis für Chemie erhalten hatte. Durch großzügige Zuwendungen aus dem Vermögen einer von Bosch begründeten Stiftung konnte die Stadt Heidelberg ab 1933 auf dem Gelände eines aufgelassenen Friedhofs einen eigenen Tiergarten einrichten. In einem Jubiläumsband zum 50jährigen Bestehen des Zoos wird Bosch als „Freund alles Menschlichen“ bezeichnet, dem nichts so sehr am Herzen gelegen habe, wie die „Beschäftigung mit den Wundern der Natur“.
Durchgängig unterschlagen wird in den Lobreden auf Bosch der Umstand, dass dieser seit 1925 Vorstandsvorsitzender des Chemiekonzerns I.G.-Farben war. Unter seinem Vorsitz unterstützte der Konzern im Jahre 1933 den Wahlkampf der NSDAP mit 400.000 Reichsmark - die höchste Einzelspende der deutschen Wirtschaft an die Hitler-Partei - und bereitete damit den Weg zur NS-Diktatur wesentlich mit. 1935 übernahm Bosch den Vorsitz des Aufsichtsrates, 1938 wurde er zum NS-Wehrwirtschaftsführer ernannt. Die I.G. Farben, die sich über „Arisierung“ konkurrierender Unternehmen zu einem der größten Chemie- und Rüstungskonzerne der Welt aufgeschwungen hatte, war für die Nazis von höchster wehrwirtschaftlicher Bedeutung: u.a. stellte sie synthetisches Benzin oder kriegswichtigen Reifenkautschuk her. Auch anderweitig setzte Bosch sich für die Aufrüstung des NS-Regimes ein (woran weder seine persönliche Abneigung gegen Hitler noch seine nicht-antisemitische Grundhaltung ihn zu hindern vermochte): so engagierte er sich etwa in der direkt NS-Reichsminister Hermann Göring unterstehenden Lilienthalgesellschaft für Luftfahrtforschung.
Bosch, der seit 1923 in Heidelberg residierte, stand als ambitionierter Schmetterling-sammler und Hobbybotaniker den NS-affinen Plänen der Stadt, einen Heimattiergarten einzurichten, sehr aufgeschlossen gegenüber. Im Juli 1933 unterzeichnete er einen entsprechenden Gesellschaftervertrag, im November 1934 wurde „sein“ Zoo eröffnet.
Bis heute tragen Schulen und Straßen in und um Heidelberg den Namen des Zoo- „Gründervaters“ und NSDAP-Förderers Carl Bosch.
Colin Goldner
TIERBEFREIUNG #85, Dezember 2014
Aktueller Nachtrag 1: Ende 2016 beschloss der Zoo Heidelberg, seine Haltung von Orang Utans aufzugeben. Als Grund wurden die „nicht mehr zeitgemäßen“ Gehege bezeichnet, in denen gleichwohl kurz zuvor noch „gezüchtet“ wurde. Anfang April 2017 wurde die vierköpfige Gruppe in den Privatzoo Pairi Daiza im belgischen Brugelette verfrachtet. Die 28jährige Orang Utan-Dame Puan überlebte den Stress des Transportes nicht. Sie erwachte nicht mehr aus der verabfolgten Narkose.
Der Pairi Daiza-Zoo, in den die Heidelberger Orang Utans abgeschoben wurden, war in Sheridans „Zooranking 2015“, der wichtigsten internen Gesamtbewertung europäischer Großzoos (mehr als 1 Mio Besucher pro Jahr) in der Kategorie "Bildung, Natur, Artenschutz" auf dem letzten Platz gelandet (punktgleich mit dem Zoo Karlsruhe).
Aktueller Nachtrag 2: Anfang Oktober 2019 wurde Schimpanse Epulu (51) aus dem Zoo Wuppertal in den Zoo Heidelberg abgeschoben, getrennt von seiner Partnerin Kitoto, mit der er 13 Jahre lang zusammengelebt hatte.
Die Abschiebung Epulus nach Heidelberg wurde sowohl von primatologischen Fachleuten als auch in der breiten Öffentlichkeit heftig kritisert. weiter...